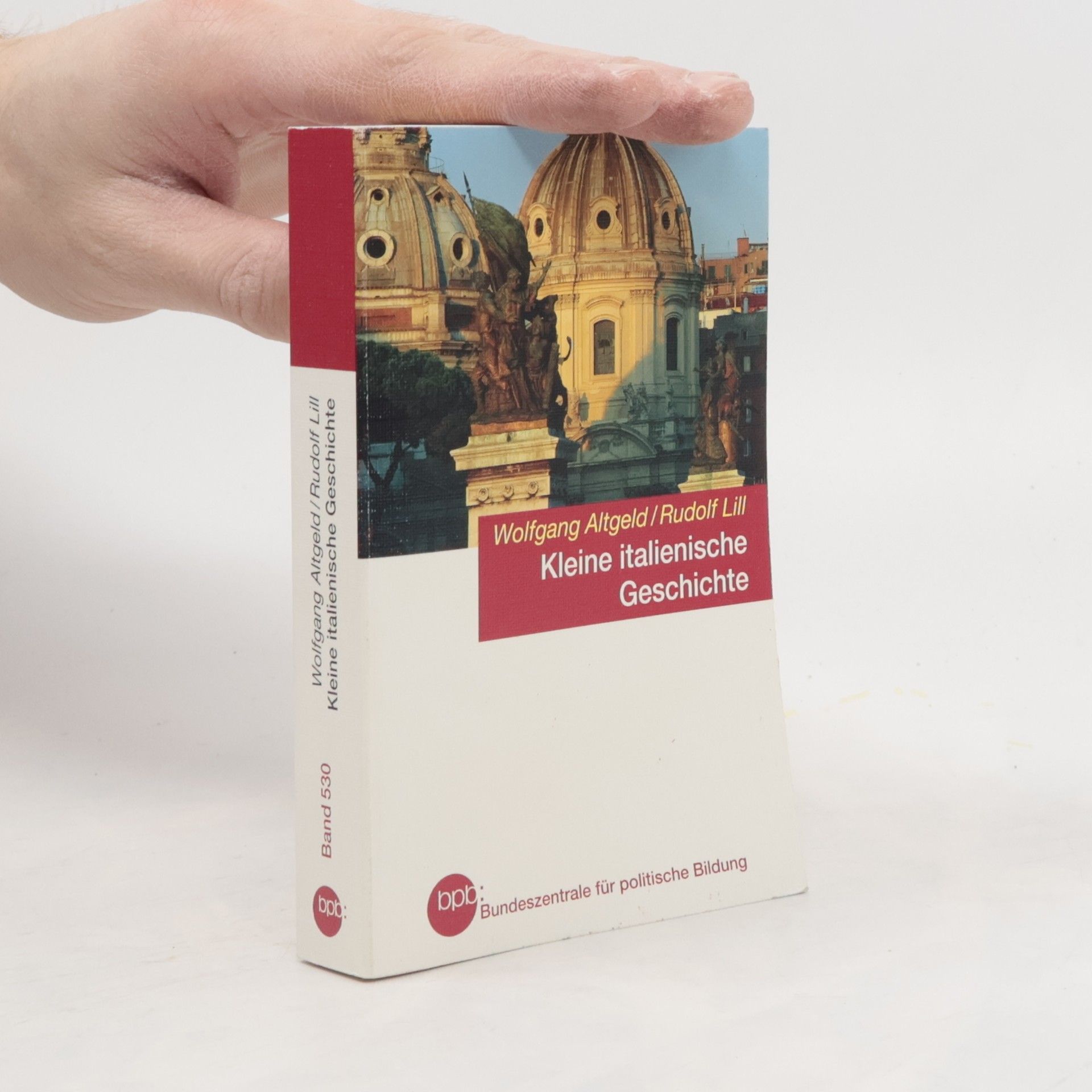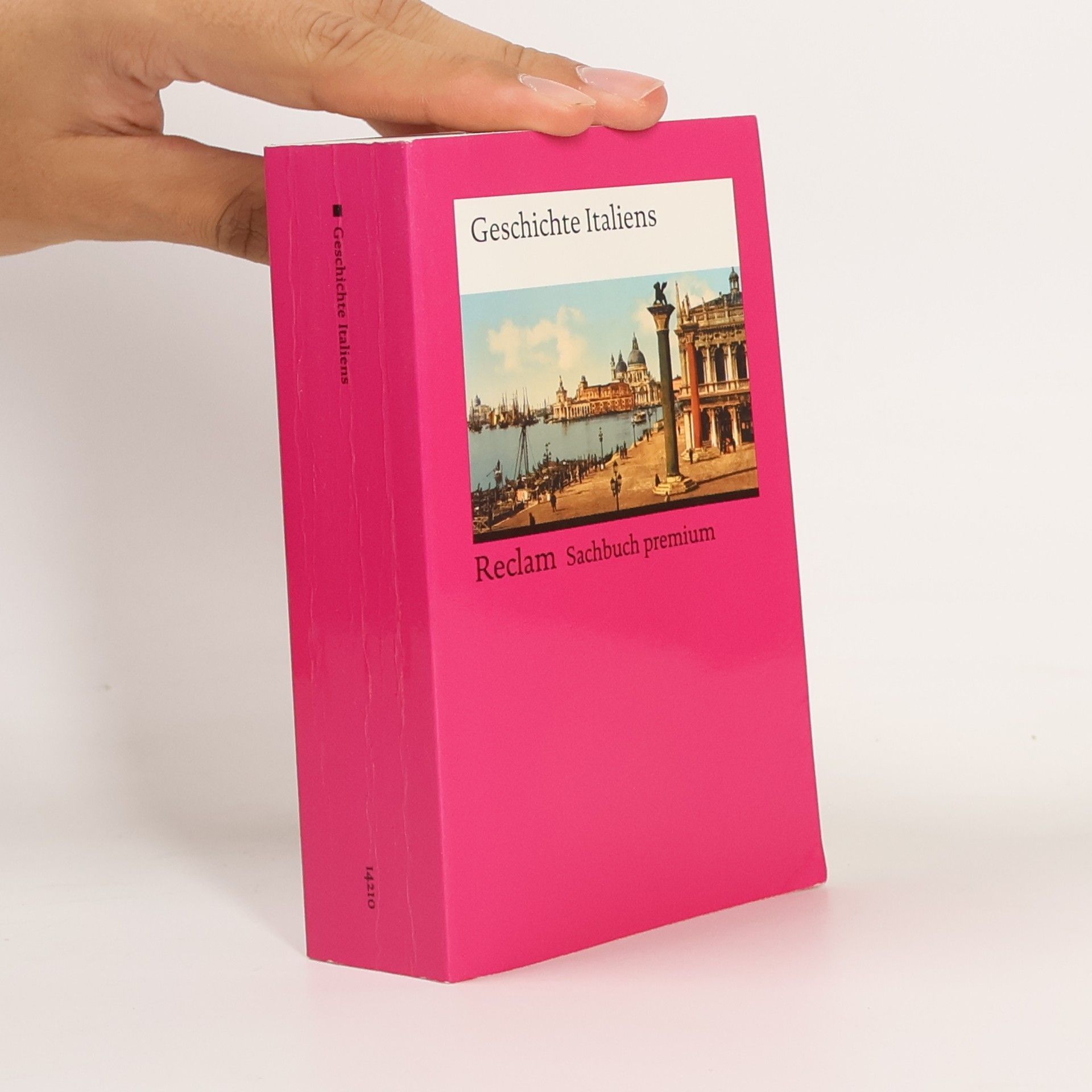Geschichte Italiens
Altgeld, Wolfgang; Frenz, Thomas; Gernert, Angelica; Groblewski, Michael; Lill, Rudolf – 14210 – Aktual. und erw. Ausgabe 2021
Italien war in Mittelalter und Renaissance mit seinen mächtigen Stadtstaaten und nicht zuletzt dem Vatikan das geistige Zentrum Europas. Zu einer Nation vereinigten sich die vielen Fürstentümer erst im 19. Jahrhundert – doch auch danach blieb die Geschichte Italiens mit der Ära des Faschismus sowie den beiden Weltkriegen turbulent. Heute ist Italien ein Kernland der Europäischen Union und nicht zuletzt ein beliebtes Urlaubsziel. Die »Geschichte Italiens« wurde für diese Neuauflage aktualisiert und um ein zusätzliches Kapitel erweitert, das die jüngsten Entwicklungen im 21. Jahrhundert behandelt – bis zu den Folgen der Covid-19-Pandemie.