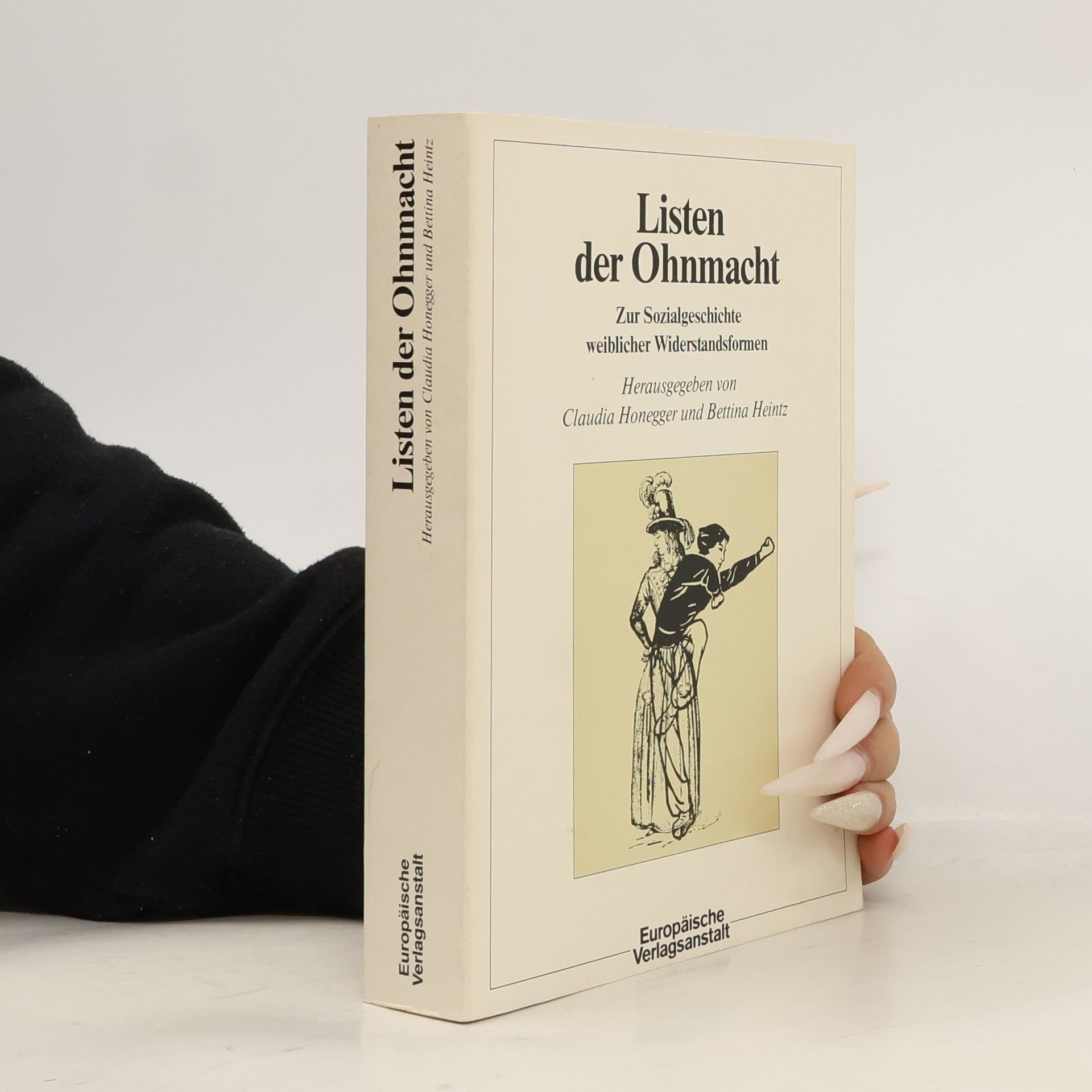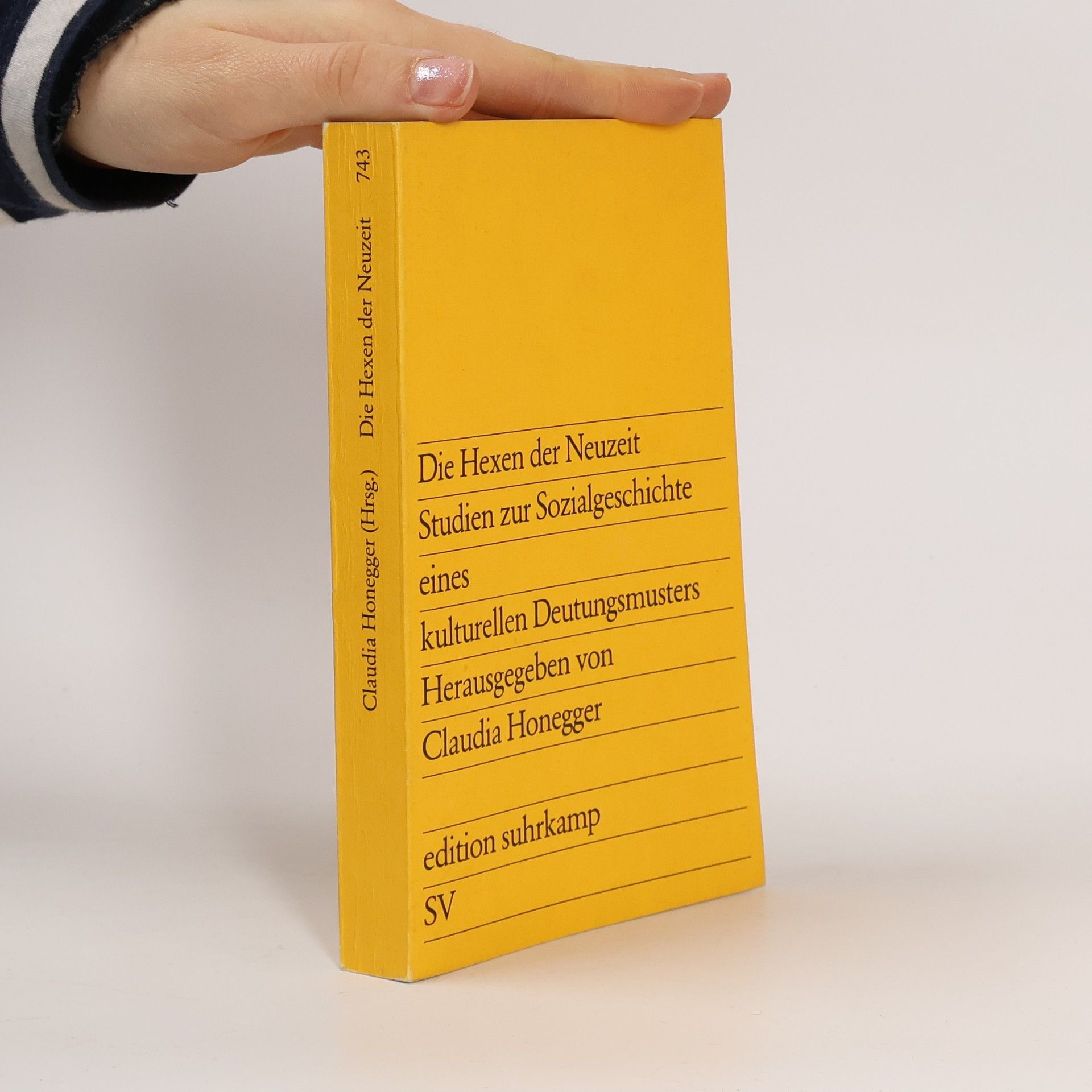Die Hexen der Neuzeit
Studien zur Sozialgeschichte eines kulturellen Deutungsmusters
Dieser Sammelband, der insbesondere Studien französischer und englischer Wissenschaftler vereinigt, bildet mit dem Band Aus der Zeit der Verzweiflung. Zur Genese und Aktualität des Hexenbildes (es 840) eine sachliche und programmatische Einheit. Er nähert sich dem Thema mit Methoden der Sozialgeschichte. »Nur die Hexen des christlichen Abendlandes sind am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit einem hypertrophen Verfolgungswahn zum Opfer gefallen, dessen Besonderheit durch den Hinweis «auf hexereiähnlichen Phänomene» in anderen Kulturen nicht verständlicher wird. […] Die Hexen der Neuzeit betrieben oder phantasierten Hexerei als Antwort auf ihre reale Ohnmacht im Alltag. […] Das ›Schweigen der Hexen‹ der Neuzeit begleitet auch die in diesem Band versammelten Versuche. Weder die eher theoretischen noch die mehr erzählenden Passagen vermögen diese stummen Begleiterinnen dazu zu bringen, ihr Herz oder ihre Galle auszuschütten. Es gibt keine Reservate, denen man mit Mikrophon und Elektronik […] zu Leibe rücken könnte. Die Hexen der Neuzeit entziehen sich der Beobachtung wie der historischen Mythologie. Mir will scheinen, nur in einer gewissen Distanz zum Diskurs von Aufklärung und Romantik zugleich kann dieser allzu lange aus Lehrbuch und Bewusstsein ausgesperrte […] Abschnitt abendländischer Geschichte durch die Betroffenen produktiv in gegenkulturelle Deutung überführt werden.«