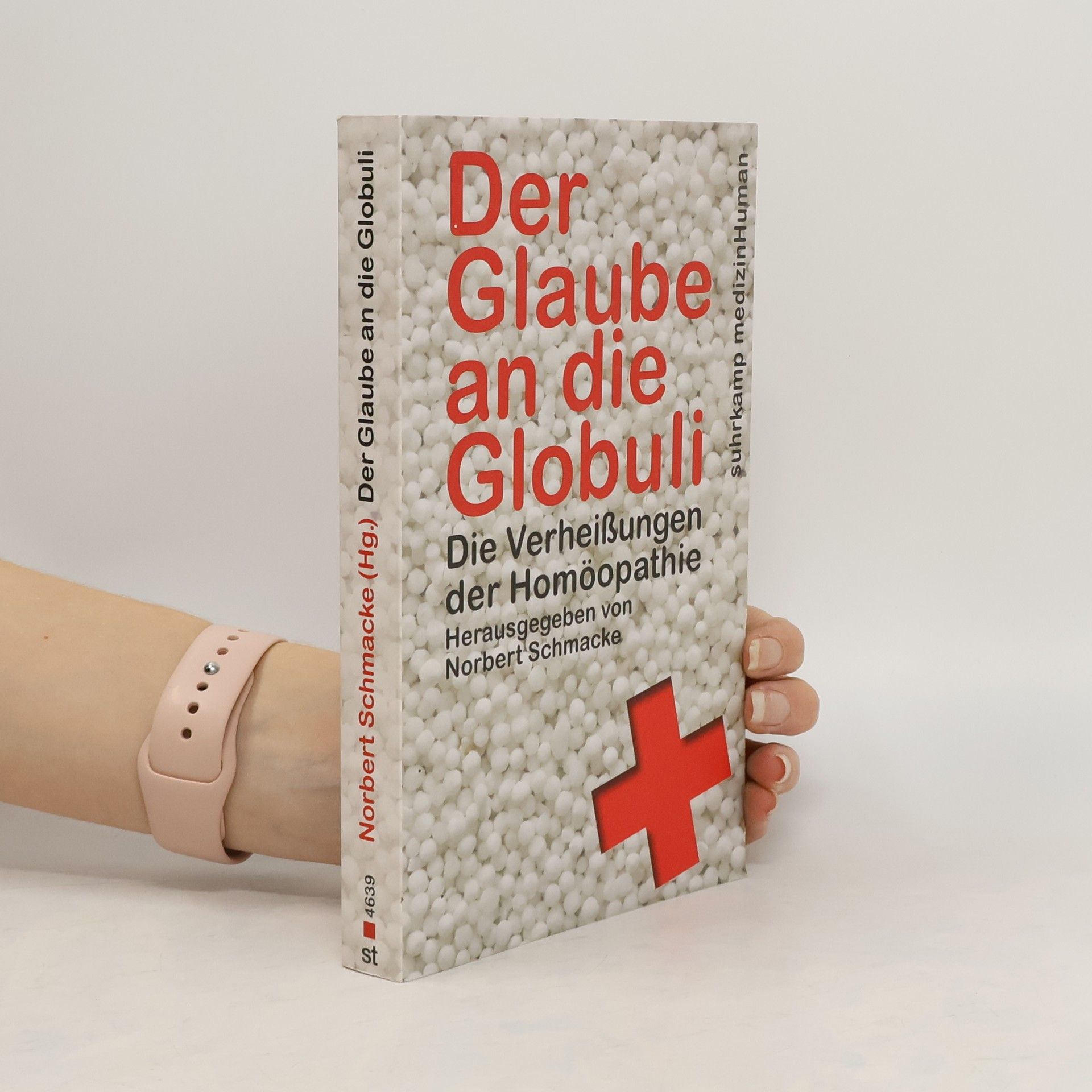Vertrauen in die Medizin
Warum sie es verdient und wodurch es gefährdet wird
Die Medizin hat in den letzten Jahrzehnten außergewöhnliche Fortschritte gemacht. Trotzdem suchen viele Menschen ihr Heil in der sogenannten Alternativmedizin, die Wirksamkeitsnachweise fast immer schuldig bleibt. Der Autor sieht die Gründe für die Abkehr von bewährten medizinischen Behandlungen zum einen darin, dass es im medizinischen Alltag immer wieder versäumt wird, auf den kranken Menschen mit seinen eigenen Perspektiven verständig einzugehen, zum anderen im von der Alternativmedizin leicht zu missbrauchenden Autonomiebedürfnis des Menschen. Wie kann das Vertrauen von Patientinnen und Patienten in wissenschaftlich erprobte Verfahren gestärkt werden? Norbert Schmacke zeigt auf, was sich im Gesundheitswesen ändern muss, damit die Fortschritte der evidenzbasierten Medizin allen Menschen zugutekommen können.