Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache
- 426 stránek
- 15 hodin čtení
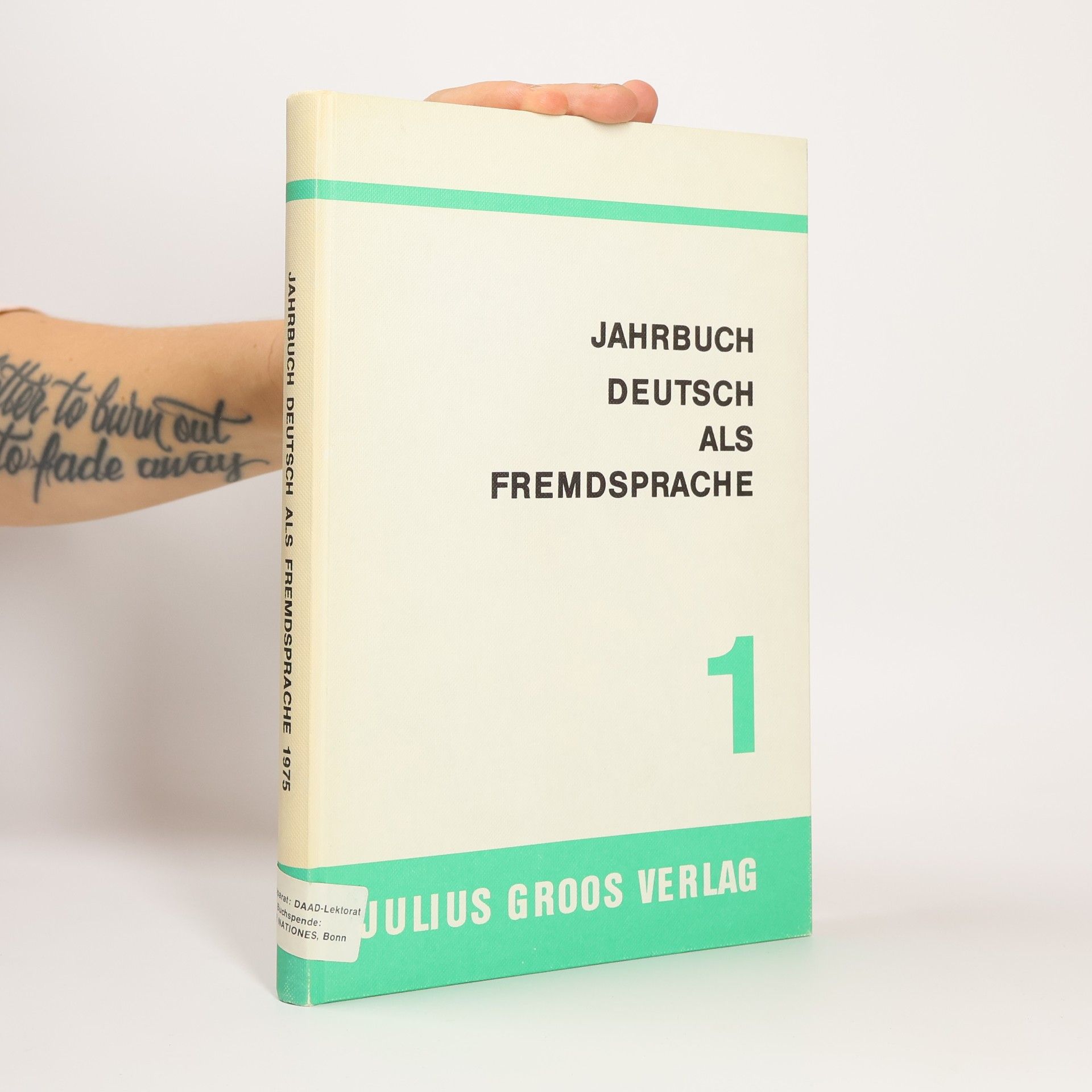



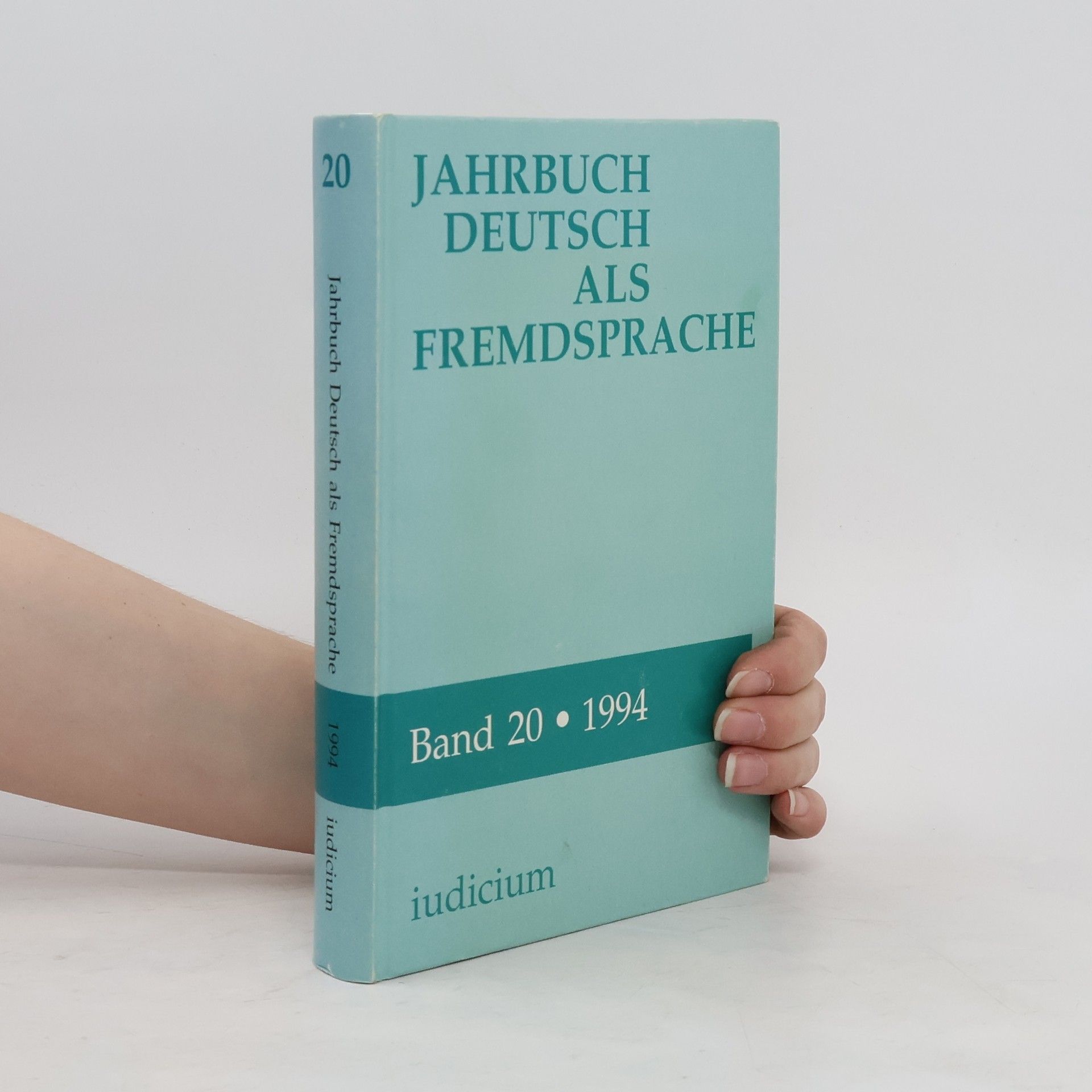
Lessings ‚Emilia Galotti‘ und Goethes ‚Iphigenie auf Tauris‘ als Dramen bibelkritischer bzw. rechtspolitischer Sicherung menschlichen Lebens und Zusammenlebens
Das vorliegende Buch schliesst zwei beruhmte Dramentexte der deutschen Aufklarung an Probleme der heutigen Weltgesellschaft an, die Gemeinwohlbelang beanspruchen durfen. Lessings 'Emilia Galotti' wird als Sicherung menschlichen Lebens und Zusammenlebens durch die glaubensgehorsame Hingabe der Titelheldin an die Uberwindung vernunftwidriger biblischer Lebenslehren interpretiert, Goethes 'Iphigenie auf Tauris' als Darstellung der vertraglichen Grundlegung eines globalen menschenrechtlichen Fremdenrechts erlautert. An diese Interpretationen anknupfend legt das dritte Kapitel des Buches die fachtheoretische Empfehlung vor, das weltweite Nebeneinander der standortbewusst aufgestellten Germanistiken unter Wahrung ihrer Eigenstandigkeiten in ein plurales Miteinander im Selbstverstandnis einer multilateralen Regionalistik der deutschsprachigen Welt zu verwandeln.
Das vorliegende Buch versammelt zum ersten Mal in der Forschung Beiträge aus der Literaturgermanistik, der Geschichte, der Kulturforschung und Ernährungswissenschaft zur mehrperspektivischen und kooperativen Erforschung der literarischen Kulinaristik Thomas Manns. Teil 1 des Bandes ist übergreifenden Fragestellungen gewidmet, Teil 2 befasst sich mit Besonderheiten einzelner Werke. Im Rahmen der individuellen Positionen der Beiträger knüpft das Buch unter anderem an Publikationen an, die der Herausgeber alleine oder mit anderen in den vergangenen Jahrzehnten zur Essensforschung vorgelegt hat: Vom Essen in der deutschen Literatur (1987), Kulturthema Essen (1993), Essen und kulturelle Identität (1997), Essen und Lebensqualität (2001), Kulinaristik (2008), Gastlichkeit (2011), Die Welt der Kulinaristik (2017) und Kulinaristik des Frühstücks (2018).
The page block is tanned. Clear and tight. Klar und fest. K.