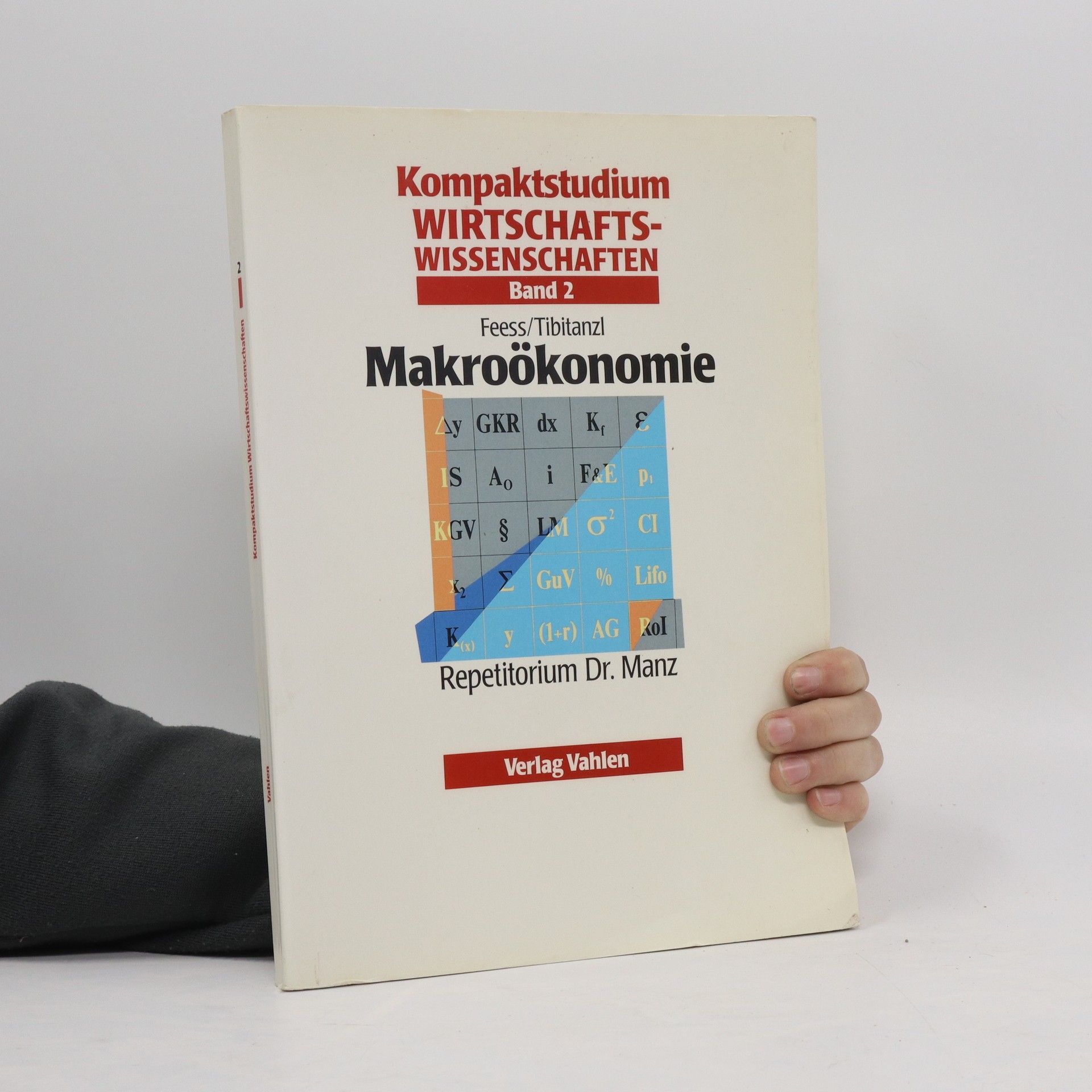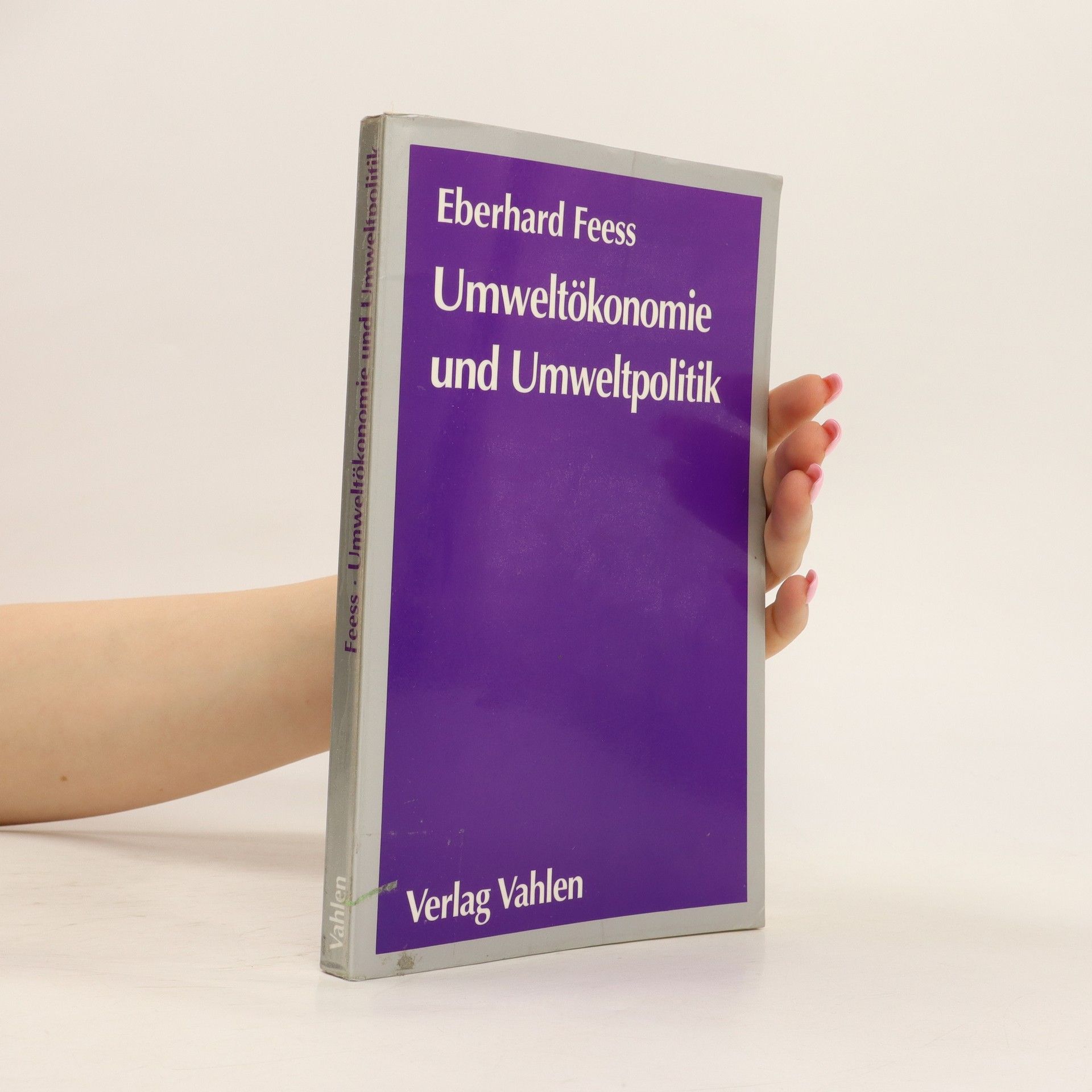Umweltökonomie und Umweltpolitik
- 249 stránek
- 9 hodin čtení
Prof. Dr. Eberhard Feess ist seit 2018 Professor für Economics an der Victoria University of Wellington in Neuseeland. Zuvor hatte er Lehrstühle an der EBS, der Goethe-Universität Frankfurt, der RWTH Aachen sowie der Frankfurt School of Finance and Management inne.Prof. Dr. Andreas Seeliger ist seit 2014 Professor für Energiewirtschaft an der Hochschule Niederrhein in Krefeld. Daneben ist er als Associate bei der Politik- und Unternehmensberatung Frontier Economics Ltd. tätig. Zuvor war er an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, der Trianel European Energy Trading, dem Energiewirtschaftlichen Institut an der Universität zu Köln sowie der Goethe-Universität Frankfurt beschäftigt.Die weiterhin rasanten Entwicklungen in der Umweltpolitik und zunehmende Relevanz des Klimawandels in Politik und Praxis führten zu umfangreichen Anpassungen in diesem beliebten Lehrbuch. Für diese Neuauflage wurden vor allem die Kapitel über die Umweltinstrumente (Auflagen, Steuern, Zertifikate) sowie die internationalen Umweltaspekte und Ressourcenökonomie grundlegend aktualisiert. Darüber hinaus wurden auch die theoretischen Kapitel einer umfassenden strukturellen und inhaltlichen Überarbeitung unterzogen.InhaltZielgruppe Studierende der Volks- und Betriebswirtschaftslehre an Universitäten und Hochschulen sowie interessierte Praktiker in Wirtschaft, Politik und Verwaltung.