Die Untersuchung beleuchtet die beeindruckenden Bauweisen der Cheops-Pyramide und bietet neue Einsichten in die verwendeten Techniken. Der Autor präsentiert mathematische und mechanische Nachweise für den Transport der Steine über einen spiralförmigen Saumpfad. In der erweiterten Auflage werden grundlegende Konzepte des Pyramidenbaus analysiert, wobei Primzahlen und terrestrische Konstanten eine zentrale Rolle spielen. Zudem werden zahlreiche Detailfragen geklärt, wie die Form der Pyramidenbasis, Maßeinheiten und die Anzahl der Arbeiter, unterstützt durch anschauliche Abbildungen und Tabellen.
Günter Fischer Knihy
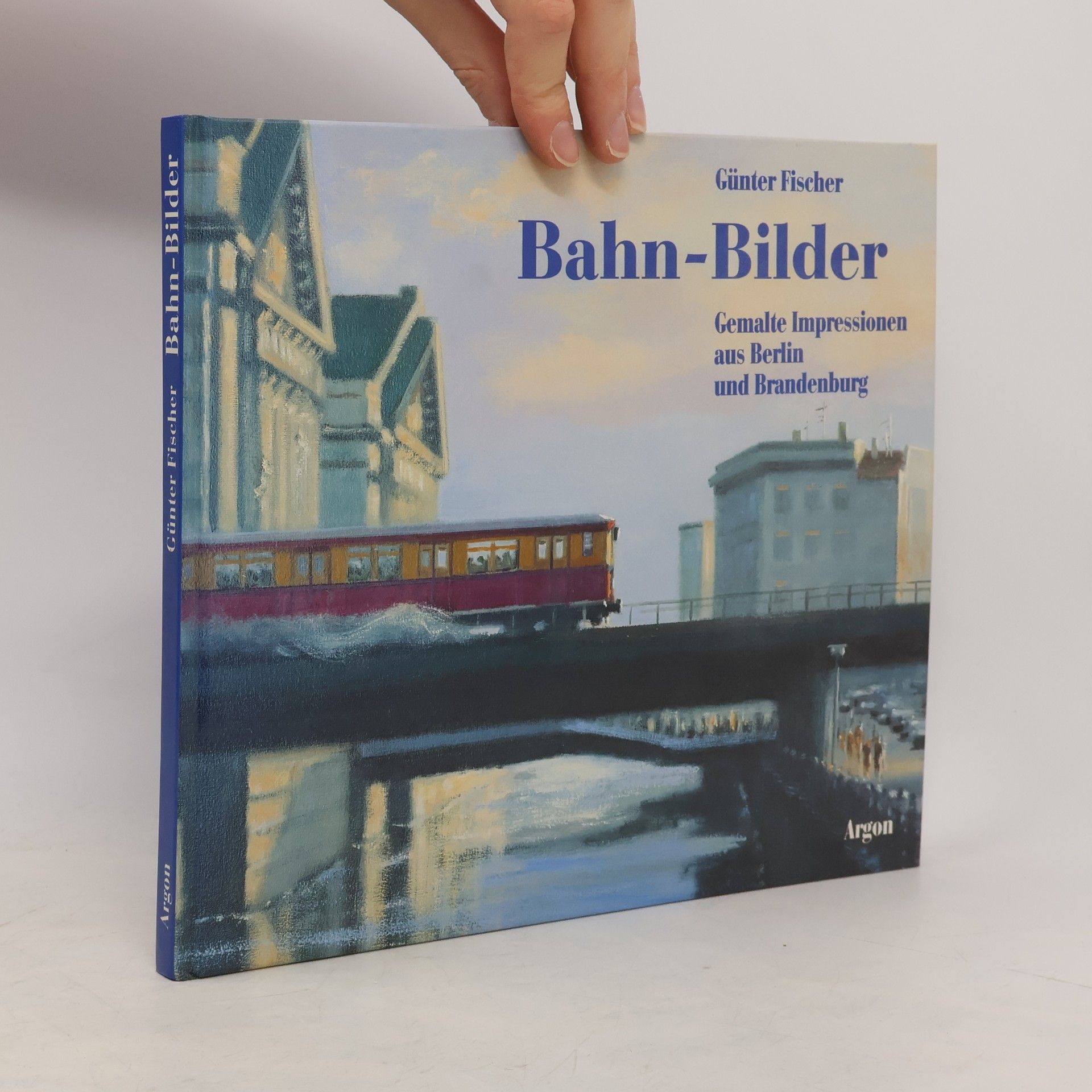




Italien war in den 1950er Jahren das Sehnsuchtsland der Deutschen und das beliebteste Reiseziel. Günter Fischer dokumentierte seine Reise mit Freunden im VW-Käfer durch die Schweiz und Italien in einem humorvollen Tagebuch, das einen authentischen Rückblick auf den Alltag dieser Zeit bietet.
Das Alphabet des Pfiffikus folgt dem beliebten Titel Das Alphabet der Tiere des Autors Günter Fischer. In diesem Buch greift er aus allen Lebensbereichen stammende, doppeldeutige Begriffe auf. Jeweils zwei von ihnen stellt er gegenüber und beschreibt sie mit kurzweiligen, lustigen oder nachdenklich stimmenden Texten. Von Thorwald Spangenberg sind sie treffend illustriert worden. Das schmale Büchlein wendet sich nicht nur an Kinder, sondern auch an deren Eltern und Großeltern.