Im Rahmen des Modellversuchs „Familien helfen Familien“ wurde angestrebt, neue Formen der Unterstützung und Verbesserung der Lebensqualität von Familien zu entwickeln. Sechs Familien- und Nachbarschaftszentren (NFZ) wurden eingerichtet, um ein Konzept der Familienselbsthilfe während der dreijährigen Modellphase (1986-1989/90) umzusetzen. Der Fokus lag auf dem Aufbau von Kontakt-, Geselligkeits- und Unterstützungsnetzen im unmittelbaren Lebensumfeld der Familien. Diese Zentren sind den Prinzipien Offenheit und Selbstorganisation verpflichtet, die für eine bedarfsgerechte Gestaltung entscheidend sind. Familienselbsthilfe ermöglicht es Familien, unabhängig von sozialen Regelungen, eigene Vernetzungsformen im Alltag zu schaffen. Die wissenschaftliche Begleitung durch das Institut Frau und Gesellschaft und das Deutsche Jugendinstitut lieferte umfangreiche empirische Ergebnisse, die in zwei Publikationen behandelt werden. Der Materialienband konzentriert sich auf die organisatorischen Aspekte der Familienselbsthilfe, während die andere Veröffentlichung breiter auf konzeptionelle Fragen eingeht. Zentrale Themen sind die Selbstorganisation an den Modellstandorten, das Zusammenspiel von Selbsthilfe und Fremdhilfe sowie die Bedingungen für eine erfolgreiche Vernetzung der Zentren. Der Band richtet sich an Praktiker im Bereich Familien- und Nachbarschaftszentren, Kommunalpolitiker, sozialpolitisch Tätige und Fachkräfte der Kinder- und Ju
Sabine Hebenstreit-Müller Knihy
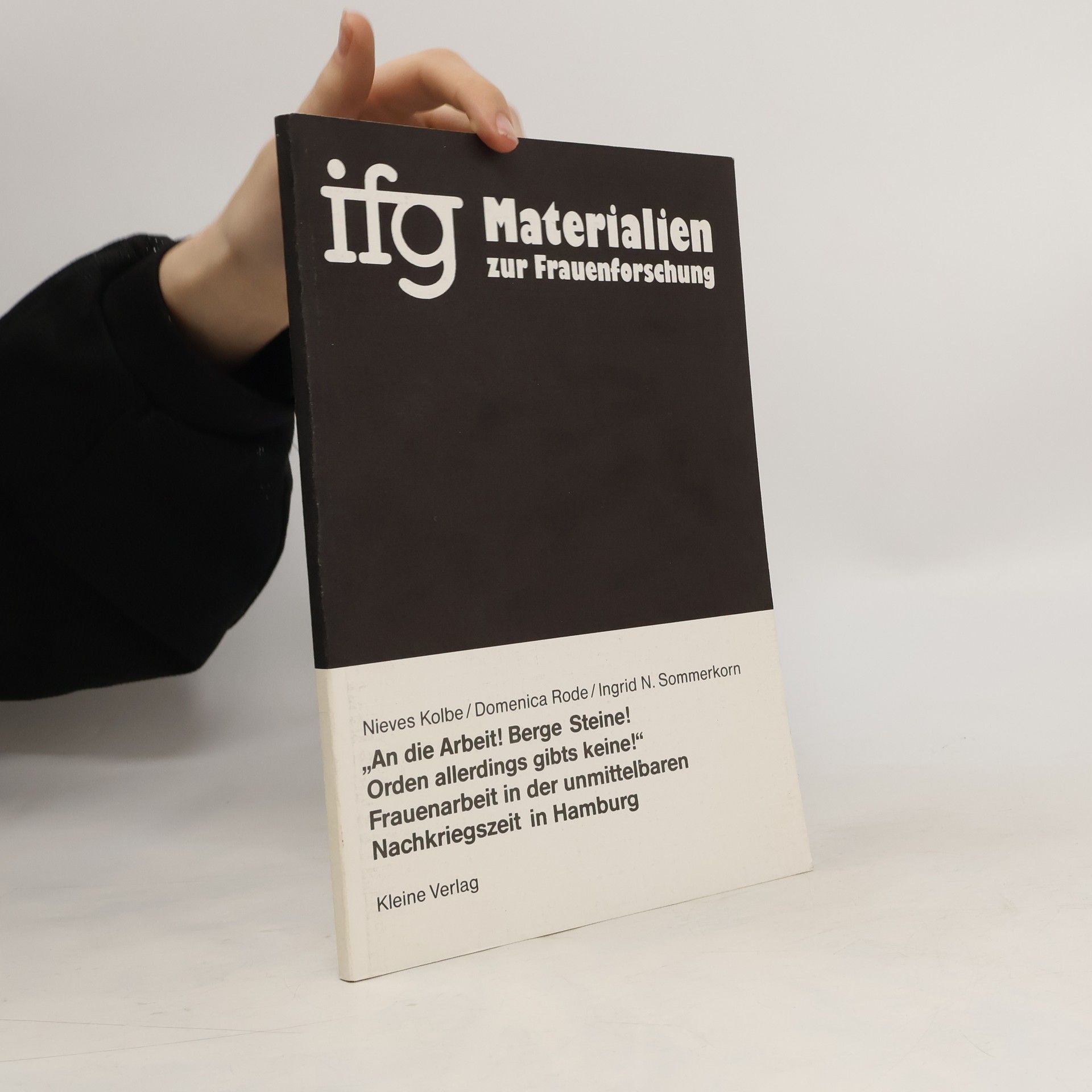
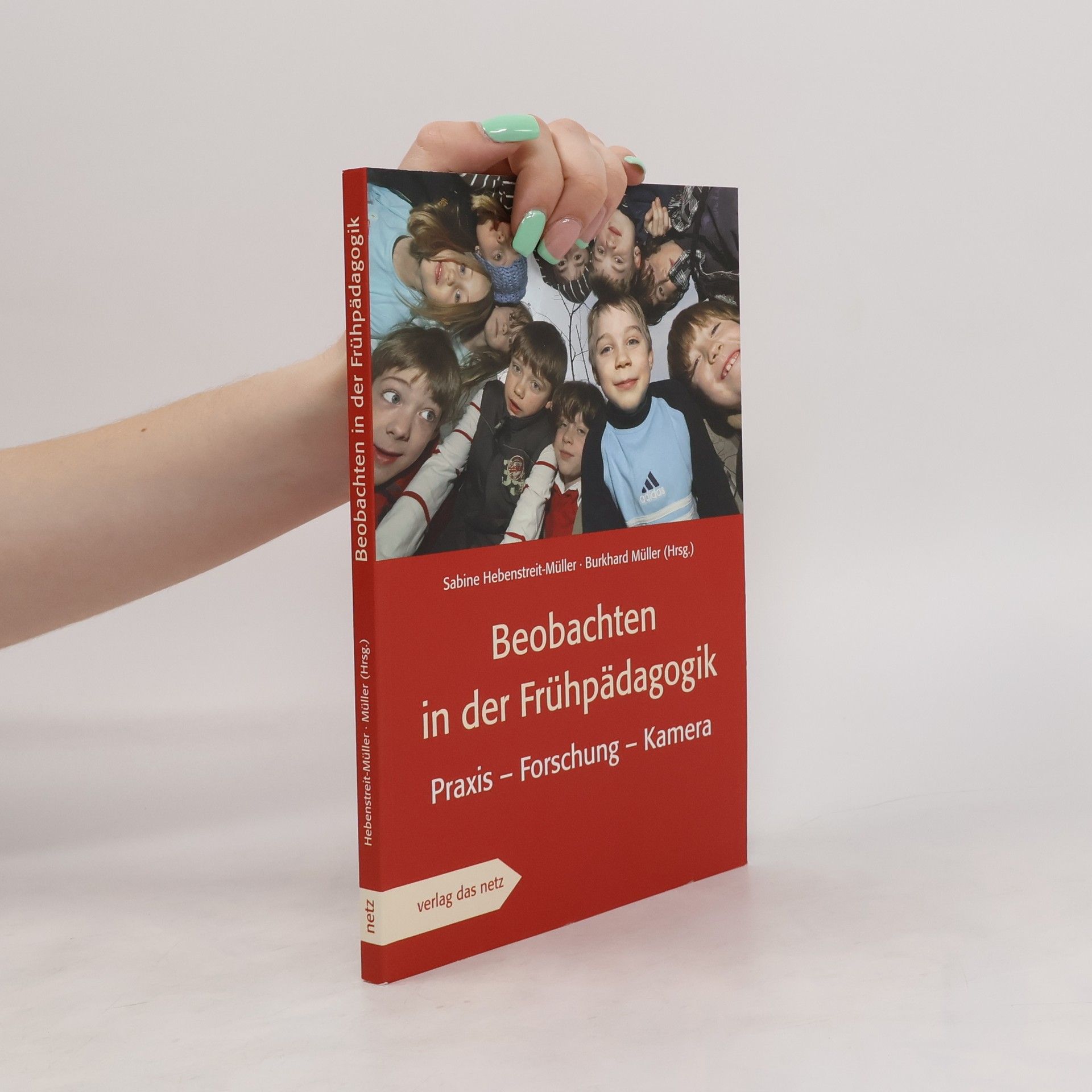

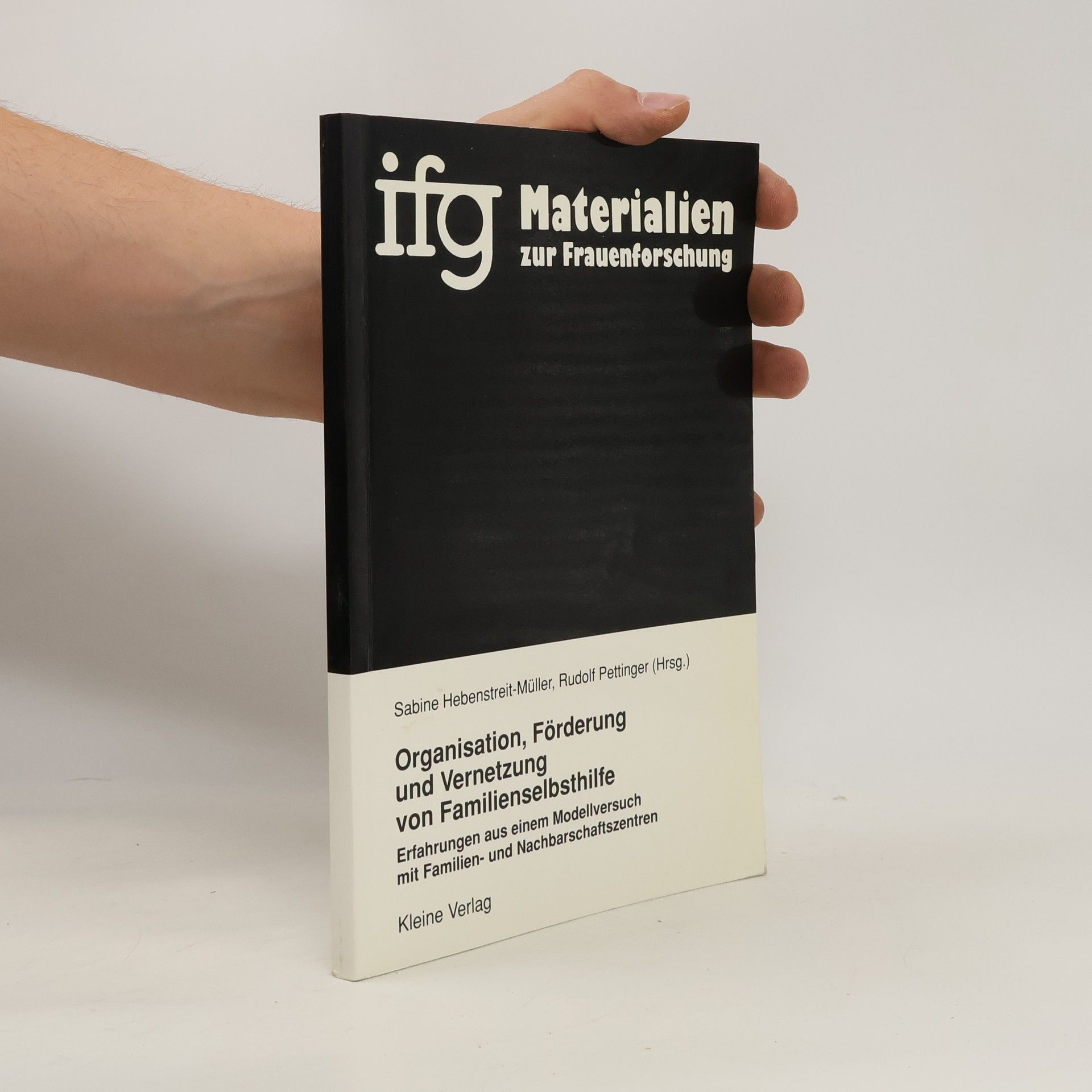
Wie gelingt professionelles Beobachten in Kitas? Was kann forschendes Beobachten dazu beitragen? Ausgangspunkt des Buches sind kameraethnografische Studien von Bina Elisabeth Mohn und Sabine Hebenstreit-Müller, die in Zusammenarbeit mit Kitas entstanden sind. Zwei zentrale Fragen stehen dabei im Mittelpunkt, die im aktuellen Fachdiskurs der Frühpädagogik noch wenig entwickelt sind: Erstens die Frage, wie in einer professionalisierten Frühpädagogik praktisch-pädagogische Tätigkeit und wissenschaftliche Forschung zusammenspielen. Und zweitens die Frage, wie sich aus dem Beobachten der Aktivitäten von Kindern Angebote ihrer Förderung entwickeln können. Das Buch eignet sich als anschauliches Studienmaterial für die Aus- und Fortbildung von pädagogischen Fachkräften in Praxis, Leitung und Beratung und ist zugleich ein innovativer Beitrag zur Fachdiskussion. Kita-Pädagogik als Blickschule
In ländlichen Regionen hat ein tiefgreifender sozialer Wandel stattgefunden, der sich an Veränderungen des Arbeitsmarktes sowie an räumlichen und sozialen Verschiebungen festmachen lässt. Diese Entwicklung geht einher mit Individualisierungsprozessen, die weitreichende Konsequenzen für die dort lebenden Menschen haben. In der wissenschaftlichen Diskussion bleiben die besonderen Lebenslagen von Frauen weitgehend unberücksichtigt, wobei oft nur die Lebenssituation von Bäuerinnen thematisiert wird. Diese eingeschränkte Perspektive blendet andere Frauen aus, wie etwa Frauen aus alteingesessenen, nicht-landwirtschaftlichen Gruppen oder Zugezogene. Zudem suggeriert die Fokussierung auf Bäuerinnen eine größere Traditionsorientierung und Rückständigkeit im Vergleich zur Stadt. Das Buch richtet den Blick auf Frauen auf dem Land, deren Gemeinsamkeit in ihrer Lebenssituation als junge Mütter liegt. Das Leben mit einem Kleinkind bedeutet, Entscheidungen über Erwerbstätigkeit, Kinderbetreuung und die Organisation des Alltags zu treffen. Auch die Fragen der „richtigen“ Kindererziehung und der Aufrechterhaltung sozialer Kontakte sind relevant. Während es bereits Studien zu jungen Müttern in städtischen Bedingungen gibt, bleibt unklar, wie das Leben auf dem Land ihre Entscheidungs- und Verhaltensmöglichkeiten beeinflusst. Das Buch untersucht die Einschätzungen und Lebensperspektiven junger Frauen und zeigt, dass ihre Ansichten zu Alltag, Ki