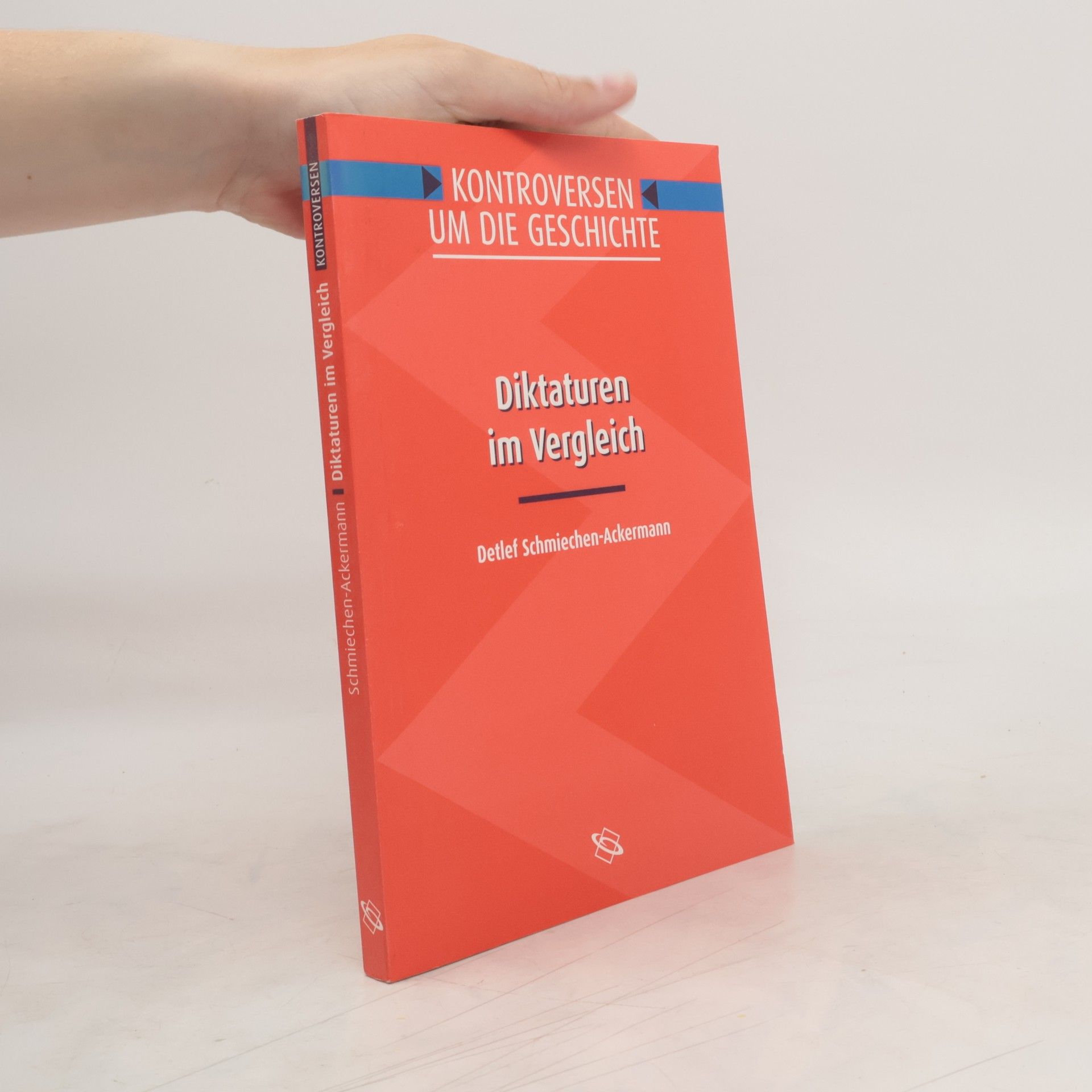Diktaturen im Vergleich
- 174 stránek
- 7 hodin čtení
Die Reihe „Kontroversen um die Geschichte“ behandelt zentrale Deutungskontroversen in der Geschichtsforschung und erleichtert die Vorbereitung auf Seminare, Referate und Prüfungen. Sie bietet eine problemorientierte, ausgewogene und kompakte Übersicht über den aktuellen Forschungsstand, beleuchtet unterschiedliche interpretatorische Positionen und präsentiert offene Diskussionen. Die Krise des Liberalismus und der Aufstieg von Diktaturen prägten die politische Geschichte des 20. Jahrhunderts entscheidend. In diesem Kontext gewinnt die vergleichende Diktaturforschung an Bedeutung für die Analyse dieser Prozesse in der Geschichts- und Politikwissenschaft. Detlef Schmiechen-Ackermann bietet einen umfassenden Überblick über dieses Forschungsfeld und erörtert die Möglichkeiten und Grenzen des vergleichenden Ansatzes. Er stellt die theoretischen Grundlagen konkurrierender Ansätze in der Diktaturforschung wie „Totalitarismus“, „politische Religion“ und „moderne Diktatur“ dar und überprüft deren Anwendbarkeit kritisch. Anhand von Fallbeispielen wie dem italienischen Faschismus, dem Nationalsozialismus, der stalinistischen Sowjetunion und der SED-Herrschaft wird das Verhältnis von generalisierenden zu differenzierenden Aspekten erörtert. Zudem skizziert er kontroverse Deutungsansätze, die in den letzten Jahren breiter diskutiert wurden.