Sozialarbeitende benötigen Handlungsstrategien, die ihnen situations- und kontextangemessene Interventionen ermöglichen. Dazu gehört der konstruktive Umgang mit Ungewissheit und Unsicherheit in komplexen und nicht eindeutigen Bearbeitungsfällen. Dabei stellt sich immer auch die Frage nach der Vermeidung von Eindeutigkeitsfallen, der Verfügbarkeit und Bedeutung fallbezogener Informationen sowie dem Transfer von abstraktem, wissenschaftlichem Wissen in professionelles Handeln. Viele Theorien der Sozialen Arbeit enthalten sich aber konkreter Handlungsanforderungen und fokussieren auf allgemeine Handlungsmaximen. In Lehre und Forschung wird dieser Aspekt zu wenig berücksichtigt. Hier setzt der Band an und gibt Hinweise, wie trotz hoher Komplexität und Mehrdeutigkeit, eigener Zweifel und paradoxer Situationen Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit durch die Entwicklung von Selbstkompetenz zu erreichen ist.
Herbert Effinger Knihy
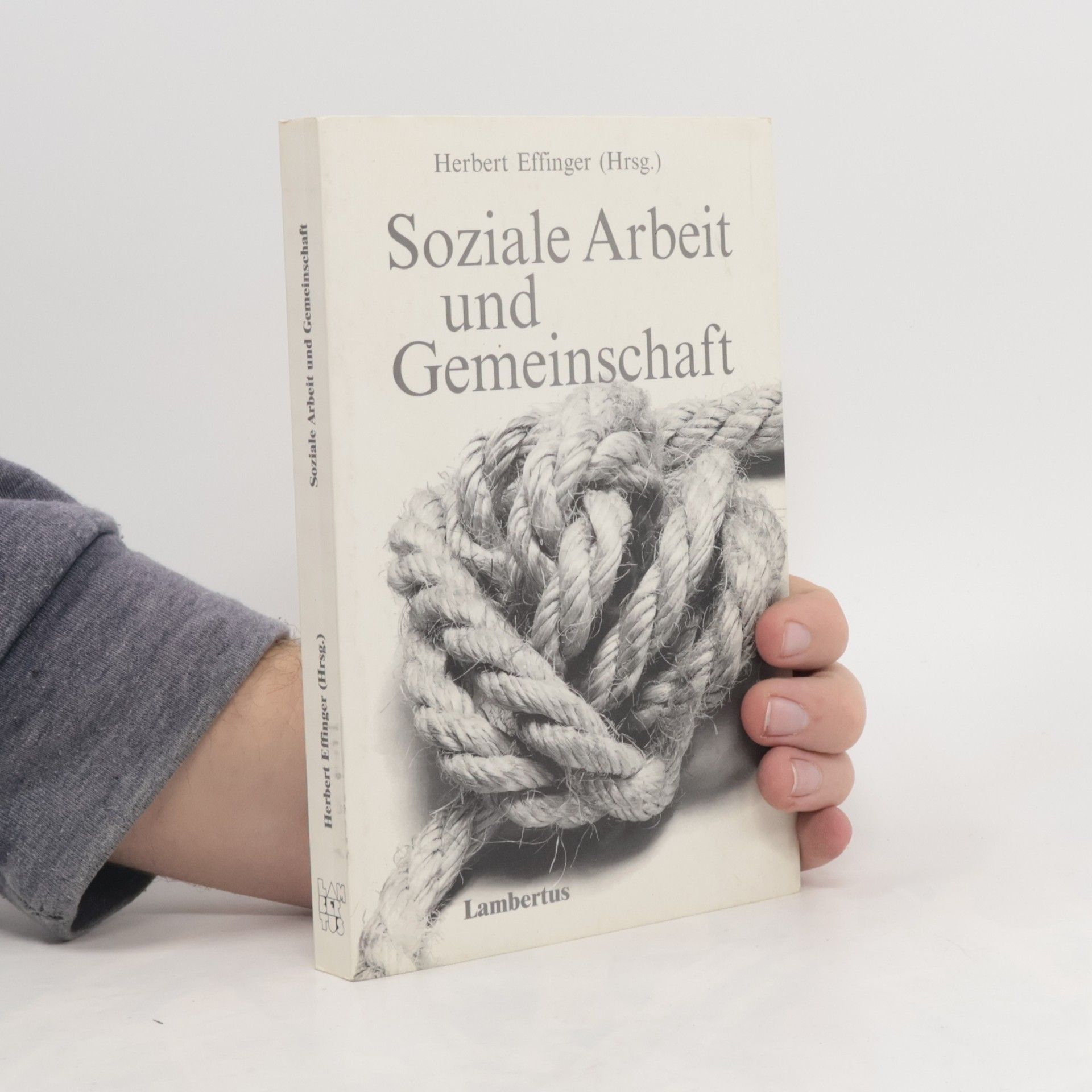


Lachen erlaubt
Witz und Humor in der Sozialen Arbeit
Soziale Arbeit und Gemeinschaft
- 218 stránek
- 8 hodin čtení
Die Dichotomisierung von Gesellschaft und Gemeinschaft zeigt vielfältige Formen und erfährt die unterschiedlichsten Bewertungen. Strittig war und Streit gab es ob der Chancen und Risiken, die diese beiden Integrationsformen beinhalten, seit bald 200 Jahren. Und nicht weniger heftig sind diese Richtungsstreitigkeiten in der Sozialen Arbeit. Gerade hier ist diese Thematik so virulent wie in kaum einer anderen Profession und wissenschaftlichen Disziplin. Doch die Soziale Arbeit zeigt gegenüber dieser Problematik eine eigenartige Ambivalenz. Sie ist kaum Gegenstand empirischer Analysen, theoretisch wie auch praktisch setzt sie mal auf inszenierte Gemeinschaften, mal weist sie diese verschämt zurück. Dieser Sammelband vereinigt Beiträge zu den verschiedenen Facetten der „Gemeinschafts“-Thematik. Sie behandeln zum einen die Bezüge von Sozialer Arbeit und Gemeinschaft und zeigen die verschiedenen Gesichtspunkte dieses zugleich interessanten und ungeklärten Verhältnisses auf. Zum anderen werden die geistes- und begriffsgeschichtlichen Hintergründe durchleuchtet, die gesellschaftliche Genese von Gemeinschaftsformen nachgezeichnet und sozialphilosophische sowie -politische Überlegungen zu den verschiedenen gemeinschaftsbezogenen Strukturprinzipien Sozialer Arbeit angestellt. Dr. Herbert Effinger ist Professor an der Evangelischen Fachhochschule Dresden.