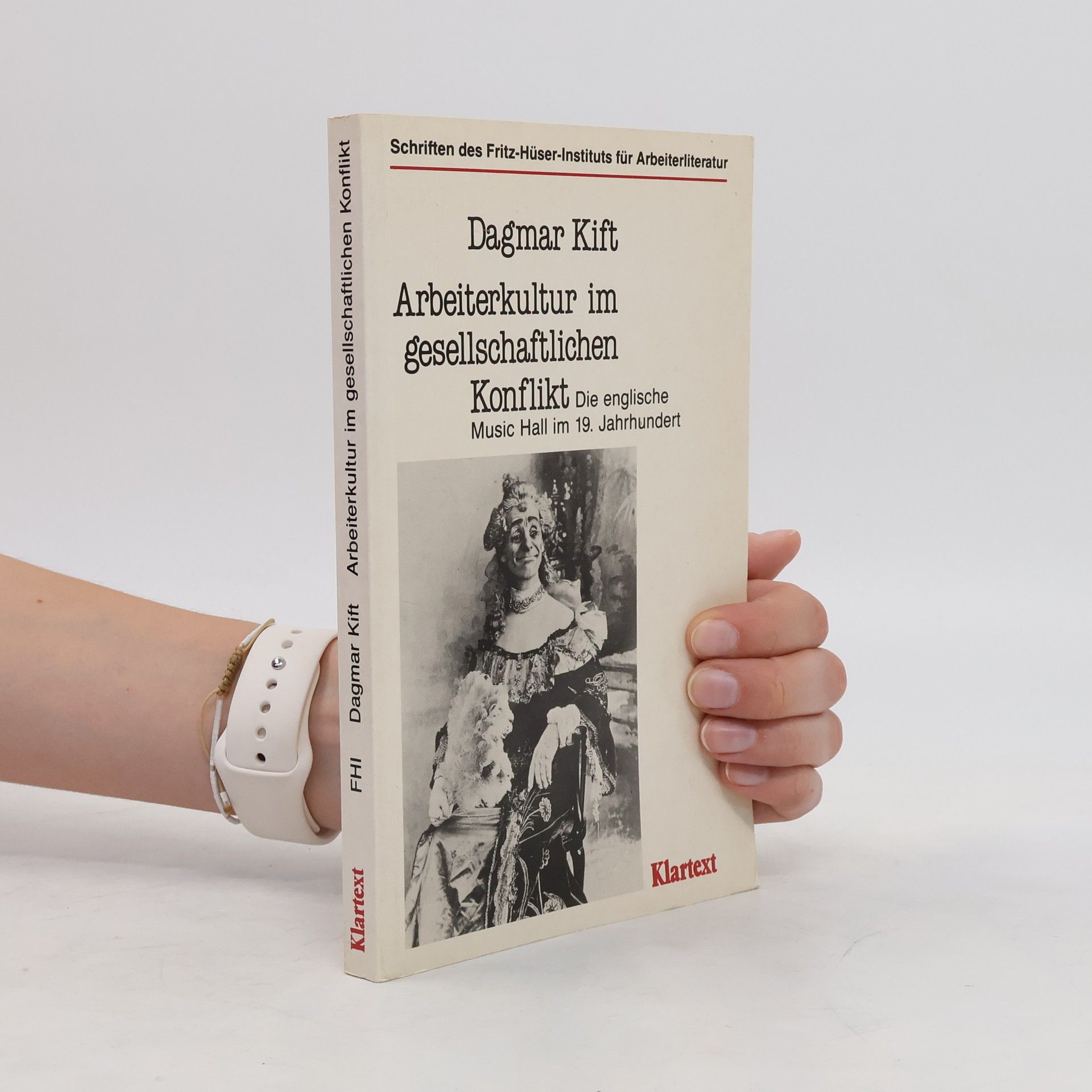Forschungen zur Arbeiterkultur sind in Deutschland meist Forschungen zur Kultur der organisierten Arbeiterschaft. In diesem Buch steht dagegen mit der Music Hall, der englischen Variante des Varieté, eine kommerzielle Einrichtung im Mittelpunkt. Mit Music Hall griff Elemente der Volkskultur auf und passte sie an die Bedürfnisse einer wachsenden städtischen Industriearbeiterschaft nach Geselligkeit, Gastronomie und Unterhaltung an. Darüber hinaus propagiert sie Werte und Verhaltensweisen, mit denen die Arbeiter und Arbeiterinnen sich identifizieren und gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen abgrenzen konnten. Deshalb entwickelte sich die Music Hall zur sowohl populärsten als auch umstrittensten Institution der englischen Arbeiterkultur. Die Autorin macht zum einen deutlich, wie eine kommerzielle Einrichtung dazu beitragen konnte, das Bewußtsein der Arbeiterschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu prägen. Zum anderen gelingt es ihr, durch eine Untersuchung der Kontroversen um die Music Hall Arbeiterkultur in einen größeren Zusammenhang zu stellen und neue Erkenntnisse zum Verhältnis von Arbeiterschaft, Gesellschaft und Staat zu gewinnen.
Dagmar Kift Knihy