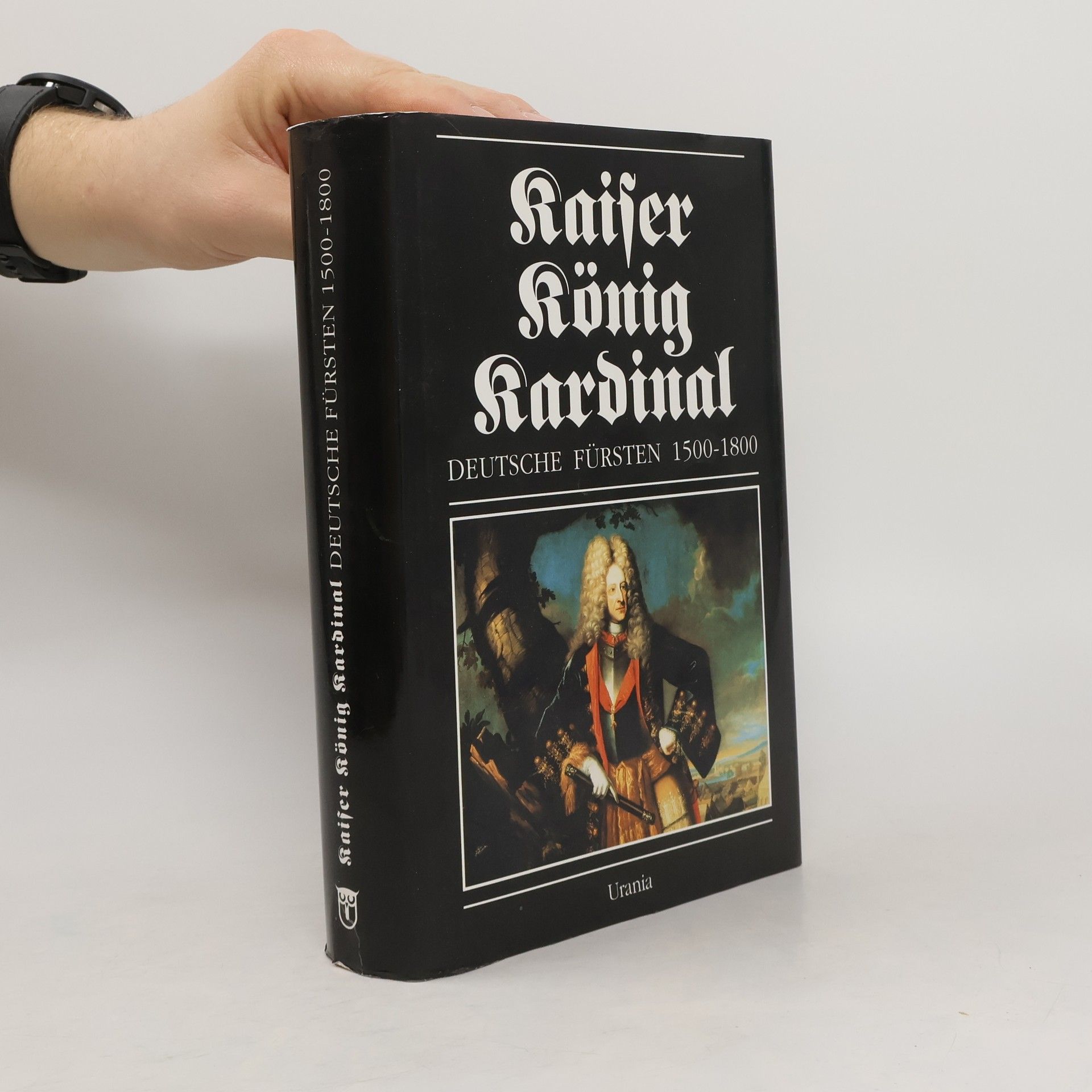Grundbesitz und Militärdienst
Kurzbiographien pommerscher Offiziere (1715 bis 1806)
- 1294 stránek
- 46 hodin čtení
Der erste Teilband bietet detaillierte Kurzbiografien, die die militärische Laufbahn bedeutender Persönlichkeiten nachzeichnen. Im zweiten Teilband wird eine umfassende Auflistung der Güter präsentiert, die mit diesen Personen in Verbindung stehen. Diese Struktur ermöglicht einen tiefen Einblick in die militärische Geschichte und deren materielle Hinterlassenschaften.