Erika Kustatscher Knihy


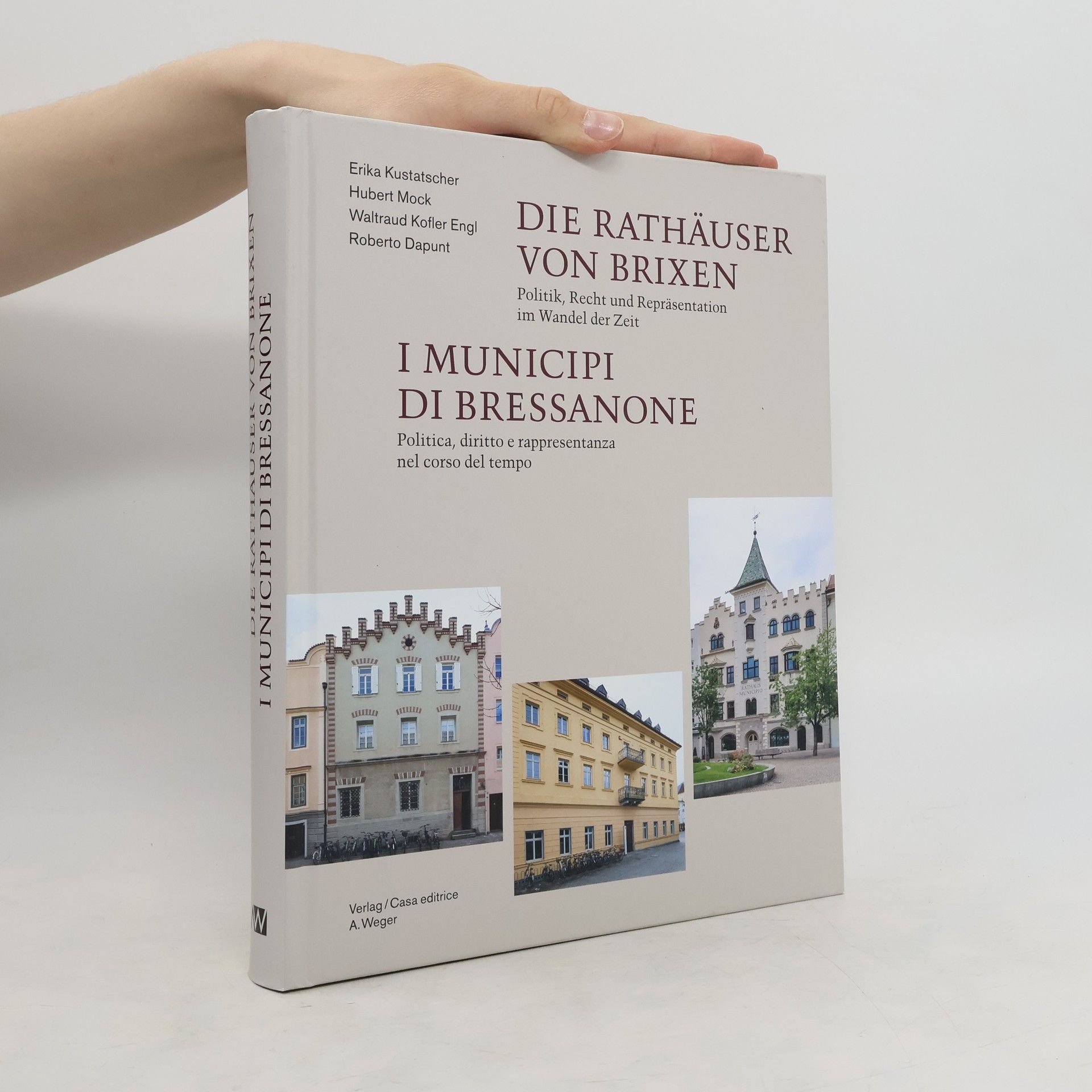
Priesterliche Vervollkommnung und Seelsorge im Raum der alten Diözese Brixen
Das Foedus Sacerdotale zwischen Katholischer Reform und Gegenwart
Die Monographie untersucht die Geschichte eines 1533 in Brixen gegründeten Priestermessbundes, der bis heute besteht. Sie analysiert das Priesterbild des 18. Jahrhunderts und vergleicht es mit zentral gelenkten Bruderschaften des 19. Jahrhunderts. Ein online Anhang bietet biographische Daten aller Mitglieder.
"Berufsstand" oder "Stand"?
Ein politischer Schlüsselbegriff im Österreich der Zwischenkriegszeit
- 680 stránek
- 24 hodin čtení
Die Studie legt am Beispiel Osterreichs in den Jahren 1933-1938 bisher nicht beachtete Aspekte des Standediskurses der Zwischenkriegszeit frei. Den Anstoss gab das Befremden uber die Diskrepanz zwischen dem grossen Aufwand bei der Errichtung der berufsstandischen Ordnung und dem sehr bescheidenen Ergebnis. Wahrend in der geltenden Meistererzahlung die autoritaren Zuge des Systems alles andere uberlagern und dazu fuhren, die Rolle der Vertreter des Standestaats als Widerstandskampfer gegen den Nationalsozialismus zu unterschatzen, zeigt die Analyse des Denkens konservativer Zeitgenossen, dass der Beruf, den ein Mensch ausubt, diesen nicht ausmachen kann. Zugrunde liegt ein Politikverstandnis, das nicht ausserlich Messbares, sondern menschliche Grundbefindlichkeiten in den Blick nimmt.