Dieses Lehrbuch zu Flexion und Wortbildung des Deutschen orientiert sich gezielt an den Studieng�ngen Bachelor und Master mit jeweils getrennten Kapiteln f�r Anf�nger und Fortgeschrittene. Der Stoff ist in Module strukturiert, die den Band zusammen mit dem Glossar au�erdem zu einem Nachschlagewerk zur Pr�fungsvorbereitung machen.Das Buch stellt die etablierte Fachterminologie vor und behandelt morphologische Einheiten, formelle und semantische Strukturen und Verfahren der Analyse mit seltenen und unproduktiven Wortbildungsarten. Dabei findet auch die Fremdwortbildung Ber�cksichtigung sowie diachrone Entwicklungen und die Wortbildung der Pr�positionen, Konjunktionen und Pronomen. Anhand von zahlreichen Beispielen werden die systematischen syntaktischen, semantischen, morphologischen und phonologischen Zusammenh�nge deutlich, die im Verlaufe der Sprachentwicklung und beim Gebrauch der W�rter zum aktuellen Stand der Wortstrukturen f�hrten. Problemorientierte Diskussionen, Musterl�sungen, �bungsaufgaben sowie Literaturhinweise zur Vertiefung unterst�tzen ein selbst�ndiges Bearbeiten des Stoffes.Daserfolgreiche Einf�hrungswerk liegt nun in einer aktualisiertenNeuauflage vor.
Hilke Elsen Knihy


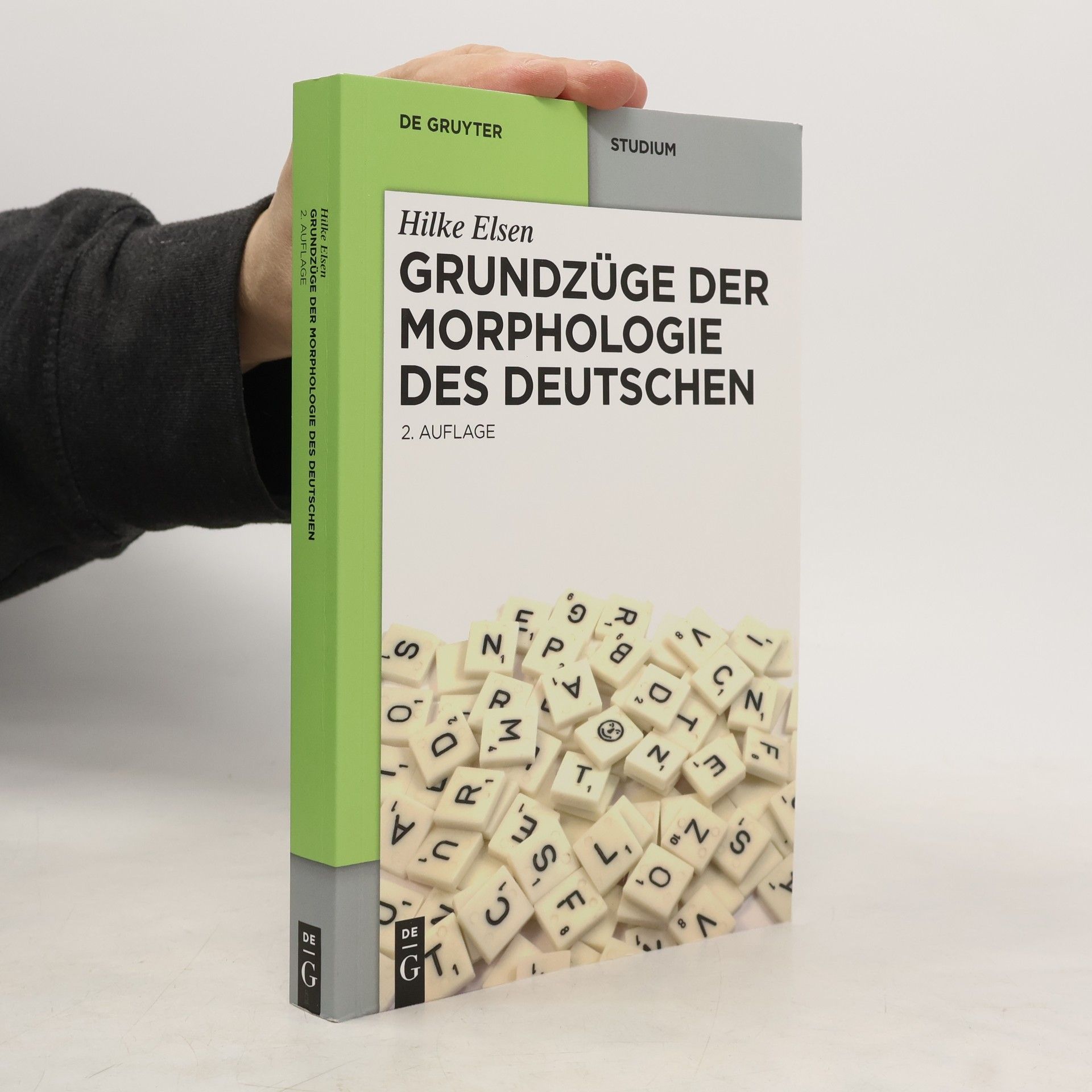
Gender - Sprache - Stereotype
Geschlechtersensibilität in Alltag und Unterricht
- 295 stránek
- 11 hodin čtení
Sprache wirkt sich auf das Denken und Handeln aus und transportiert Rollenbilder. Der Band erläutert die vielfältigen Ursachen von Geschlechterstereotypen und zeigt Möglichkeiten auf, in Lehr- und Lernsituationen oder bei der Beurteilung von Kindern gendersensibel zu agieren. Sein Fokus liegt auf der Sprache: Sie behandelt die Geschlechter nicht gleich, sondern transportiert Geschlechterstereotype, ihr Gebrauch beeinflusst unser Denken, unsere Wahrnehmung und unser Handeln. Lehrkräften und Betreuungspersonen hilft der Band, diese Zusammenhänge zu erkennen und bietet Anregungen für einen gendersensiblen Umgang in Kita, Schule oder Universität. Die Neuauflage berücksichtigt neue Studien und Entwicklungen besonders zu gendersensibler Sprache sowie trans- und intersexuellen Lebensformen.