Manfred Jakubowski Tiessen Knihy

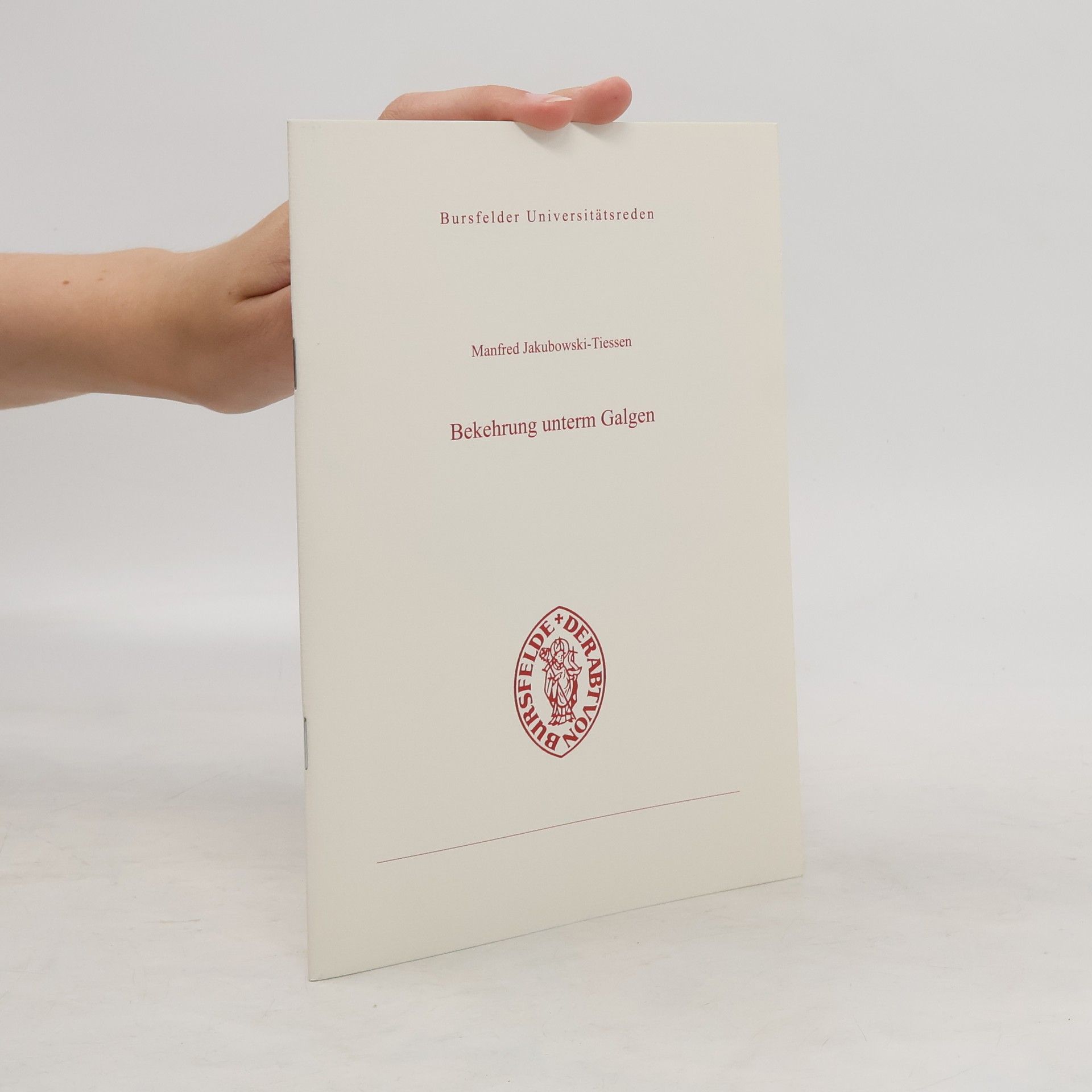
Jahrhundertwenden
Endzeit- und Zukunftsvorstellungen vom 15. bis zum 20. Jahrhundert
Isaac Newton errechnete den Anbruch des Reiches Gottes für das Jahr 2000. Wie bei anderen derartigen Berechnungen wird die Geschichte auch über dieses Datum hinweggehen. Doch warum übten Jahrhundertwenden auf die Menschen eine Faszination aus, warum wurden sie immer wieder zum Anlaß genommen, über die Vergangenheit und Zukunft nachzudenken? Die Autoren des Bandes untersuchen verschiedene Endzeitszenarien vom Spätmittelalter bis zur Zeit um 1900. Sie fragen, ob und auf welche Weise die jeweilige Jahrhundertwende auch als Zeitenwende, gar als Endzeit begriffen wurde. Daneben richtet sich der Blick auf das Spannungsverhältnis zwischen heilsgeschichtlichen Endzeitvorstellungen und weltlichen Zukunftserwartungen. So ergeben sich wichtige Einsichten in die Varianten des neuzeitlichen Säkularisierungsprozesses, in das Wechselverhältnis zwischen einer religiösen, heilsgeschichtlich orientierten Weltsicht und einem nicht religiösen, säkularen Weltverständnis.