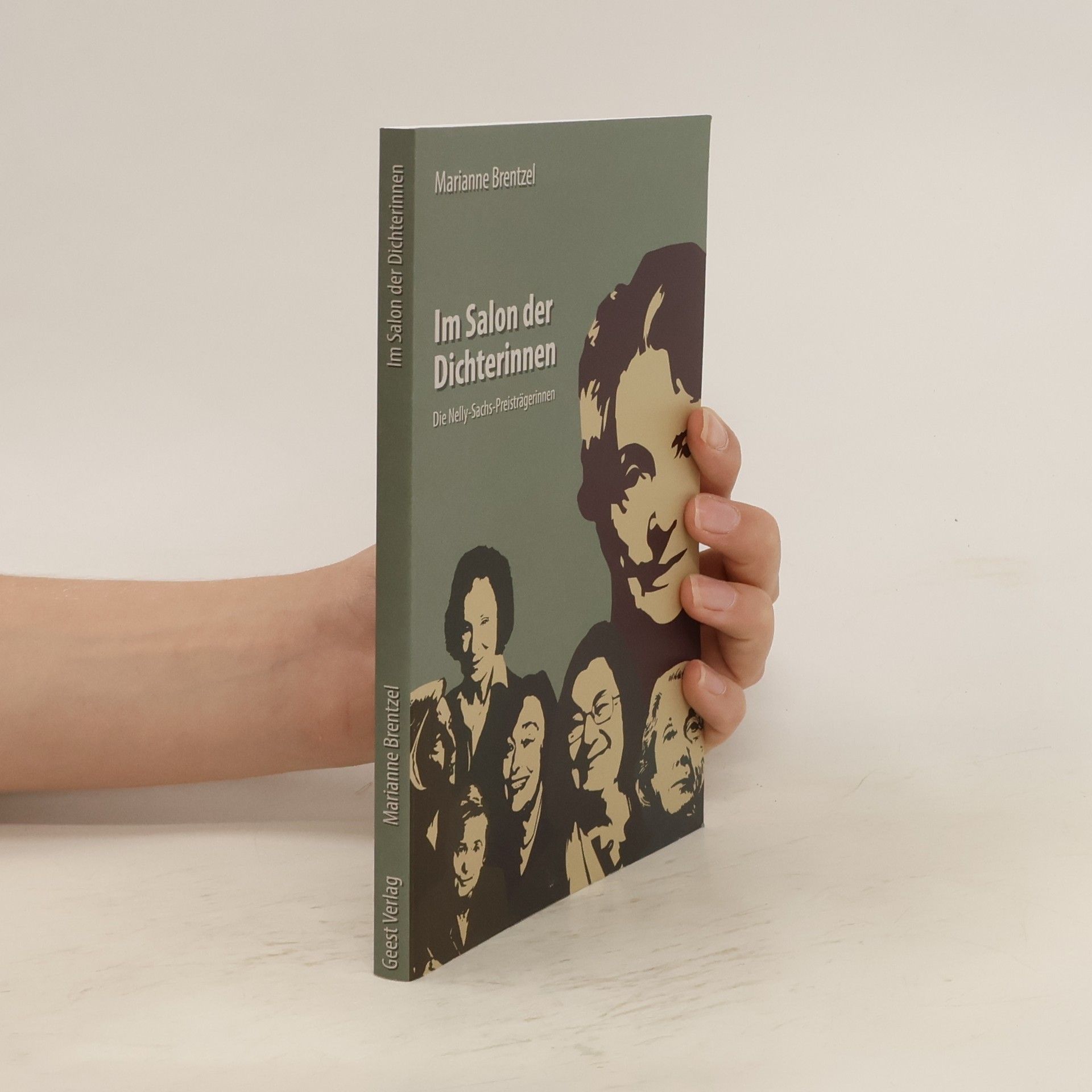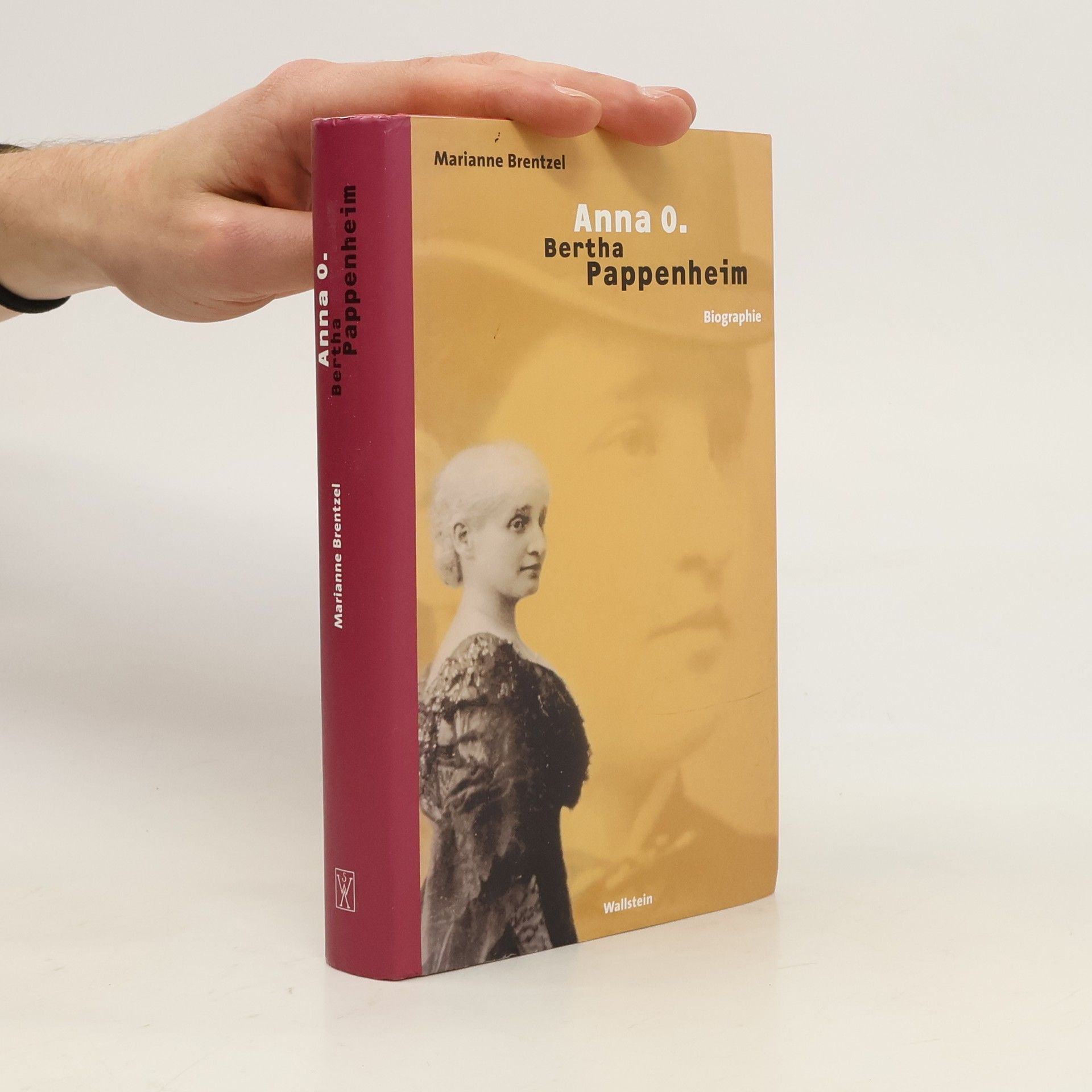Mir kann doch nichts geschehen ...
- 183 stránek
- 7 hodin čtení
Leben und Werk einer jüdischen Autorin in Deutschland mit einem Abdruck von Else Urys jüdischem Märchen "Im Trödelkeller". Als die erste Else-Ury-Biografie „Nesthäkchen kommt ins KZ“ erschien, hat ihr Schicksal zahllose Menschen erschüttert. Else Ury – die Bestseller-Autorin der beliebten Nesthäkchen-Serie – war Jüdin. Im Vordergrund der neuen Biografie steht die jüdische Tradition und ihre gleichzeitig tiefe Verwurzelung in der deutschen Kultur. Doch ihr unverwüstlicher Glaube an das deutsche Vaterland machten sie blind gegenüber der Wirklichkeit – bis zu ihrem Tod in Auschwitz. Die Autorin gewährt in der Biografie Else Urys Einblicke in das jüdische Bürgertum und entfaltet anschaulich das Panorama einer ganzen Epoche – von der Kaiserzeit bis zum Dritten Reich.