Was sind eigentlich "religiöse" Gefühle - und dürfen sie verletzt werden? Warum erscheint uns "Liebe" so wertvoll? Was genau ist eine "Meinung" und warum gibt es Grenzen der Veröffentlichung von Meinungen? Das Buch handelt davon, wie Sprache wirkt und wie diese Wirkung gezielt gegen politische Extremismen und für mehr Demokratie eingesetzt werden kann. Das Buch macht die Macht der Sprache, Wirklichkeit in Gang zu setzen, erlebbar. Es erhellt die Tatsache, dass Worte (oftmals unbewusst) Handlungsimpulse aufrufen, denen unüberprüfte Wert- und Hierarchievorstellungen zugrunde liegen. Es regt an, "Werte" auf ihren faktischen Inhalt hin zu überprüfen.
Elisabeth Schrattenholzer Knihy
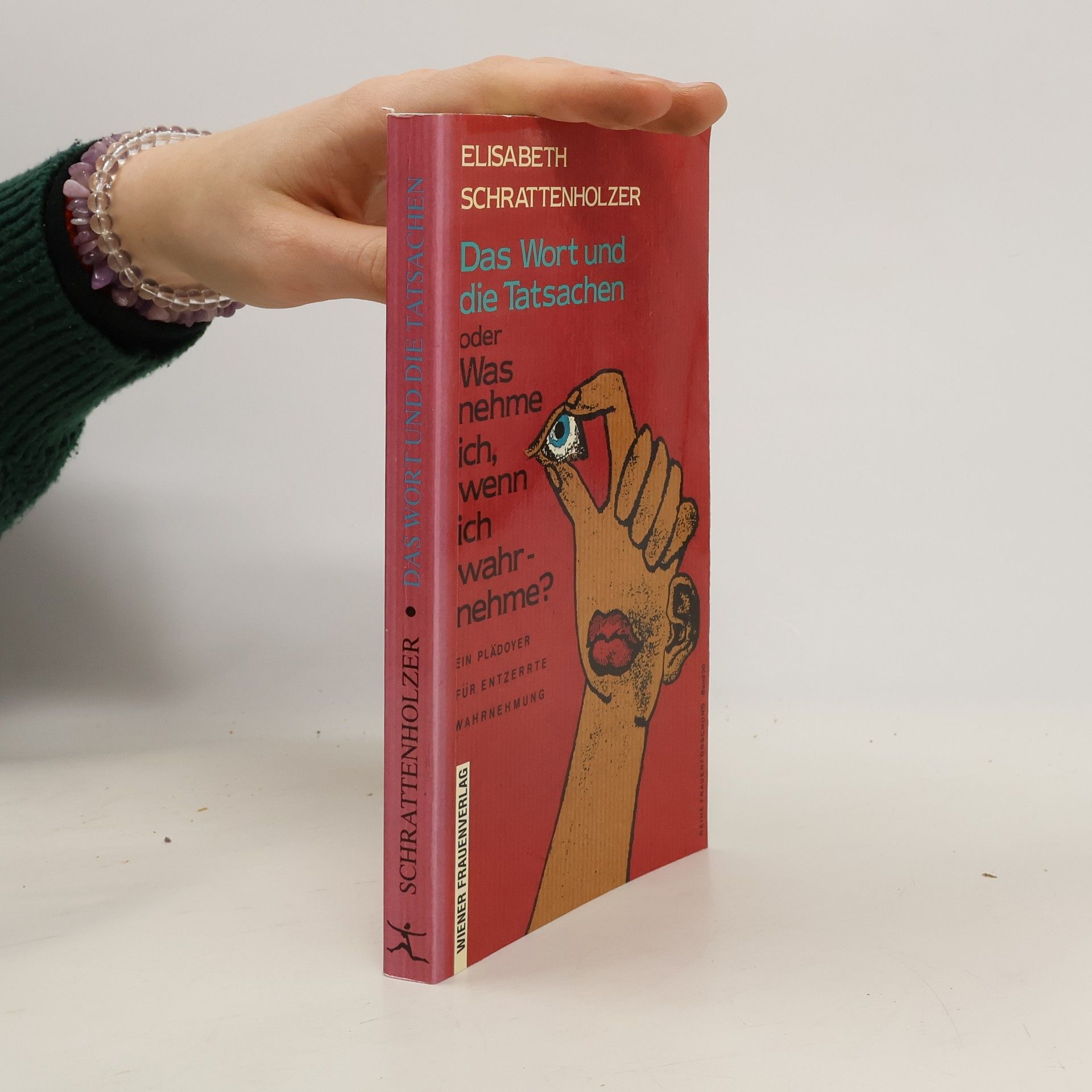
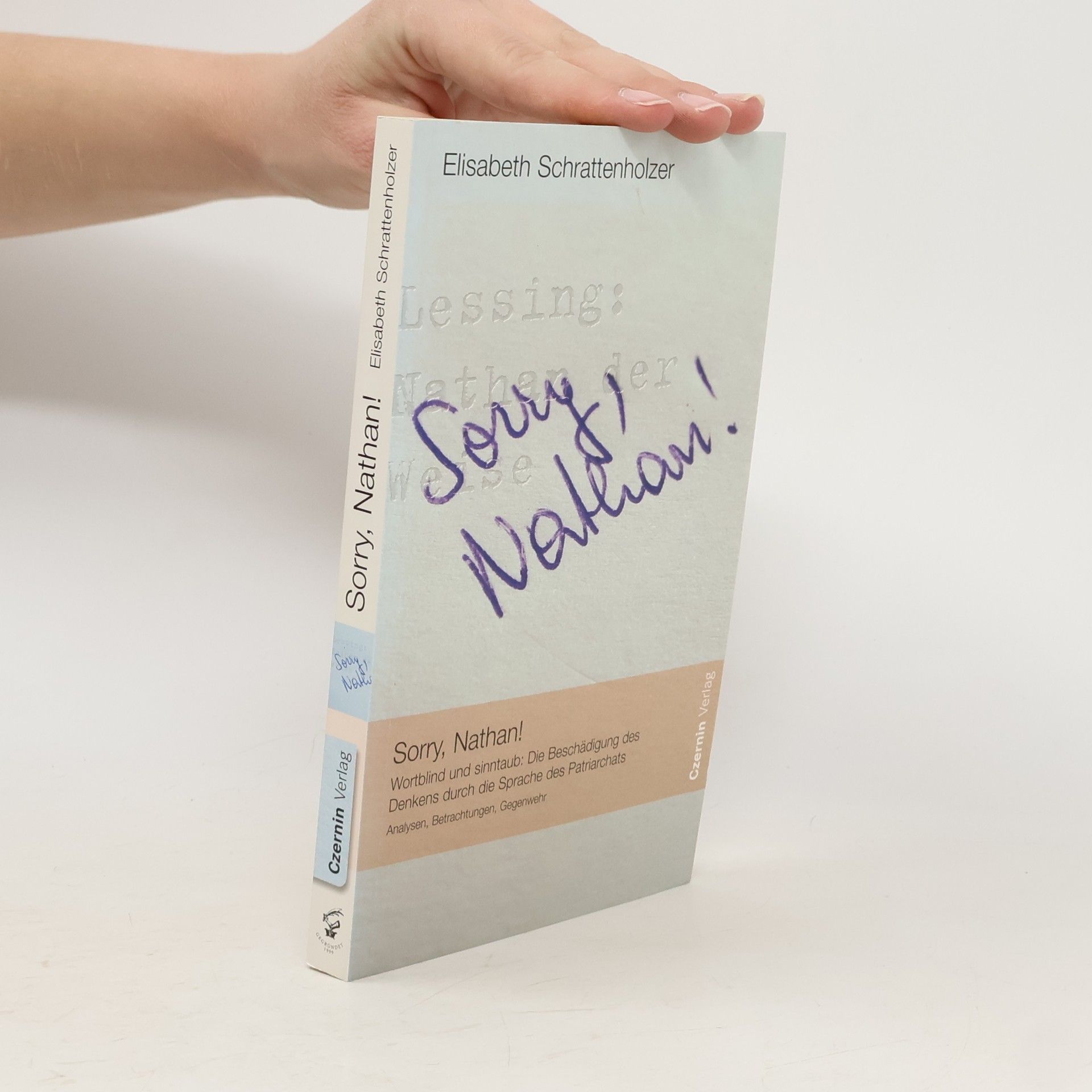
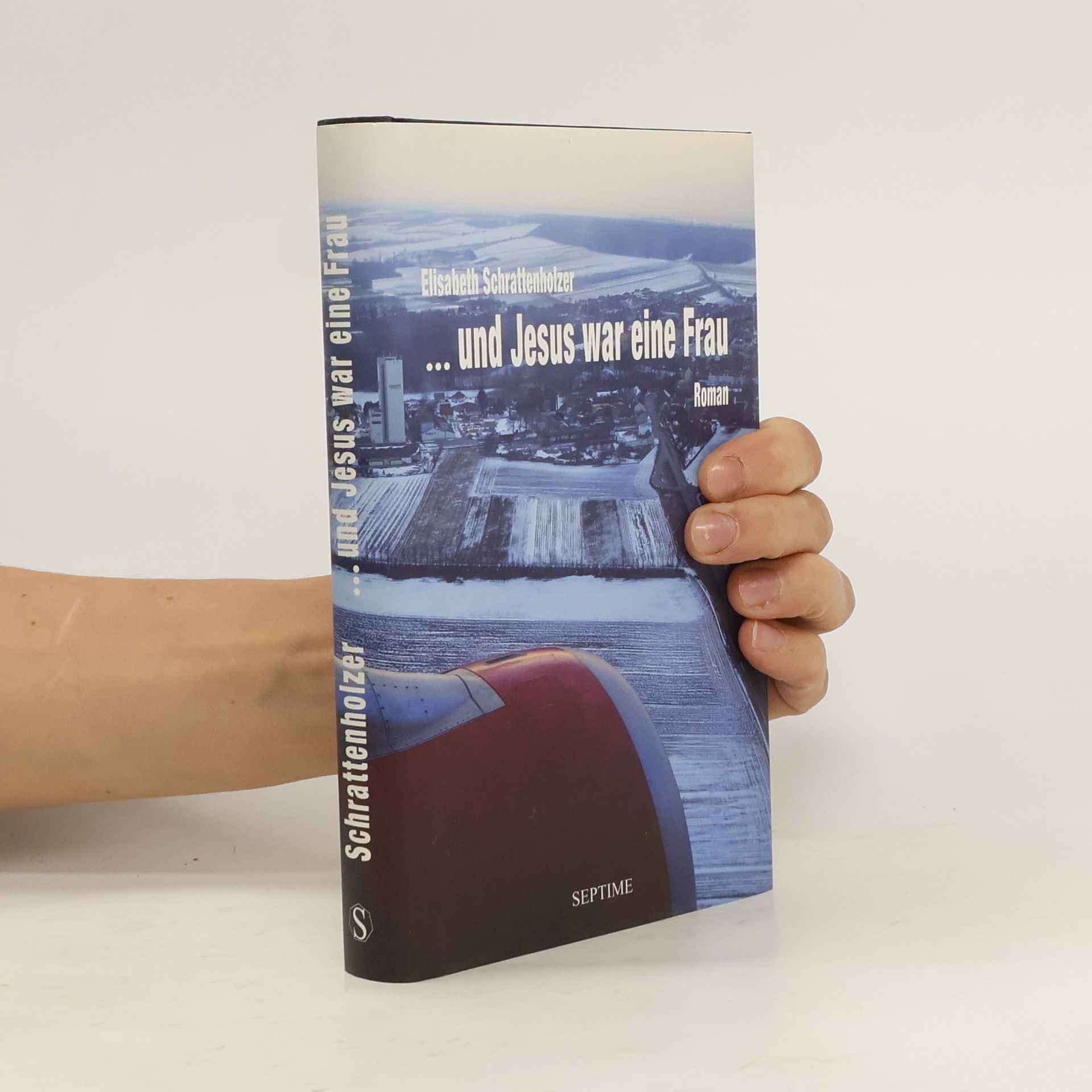
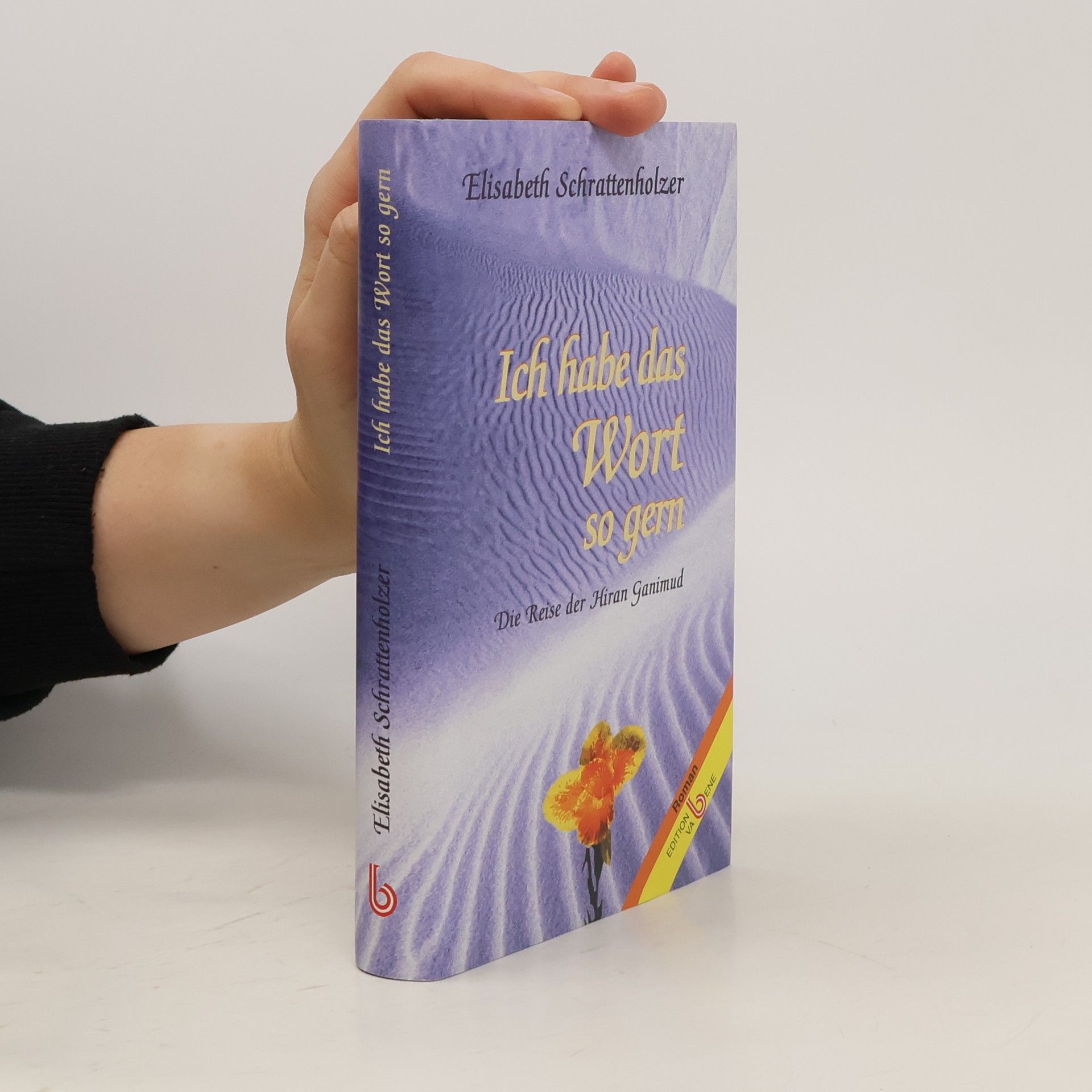

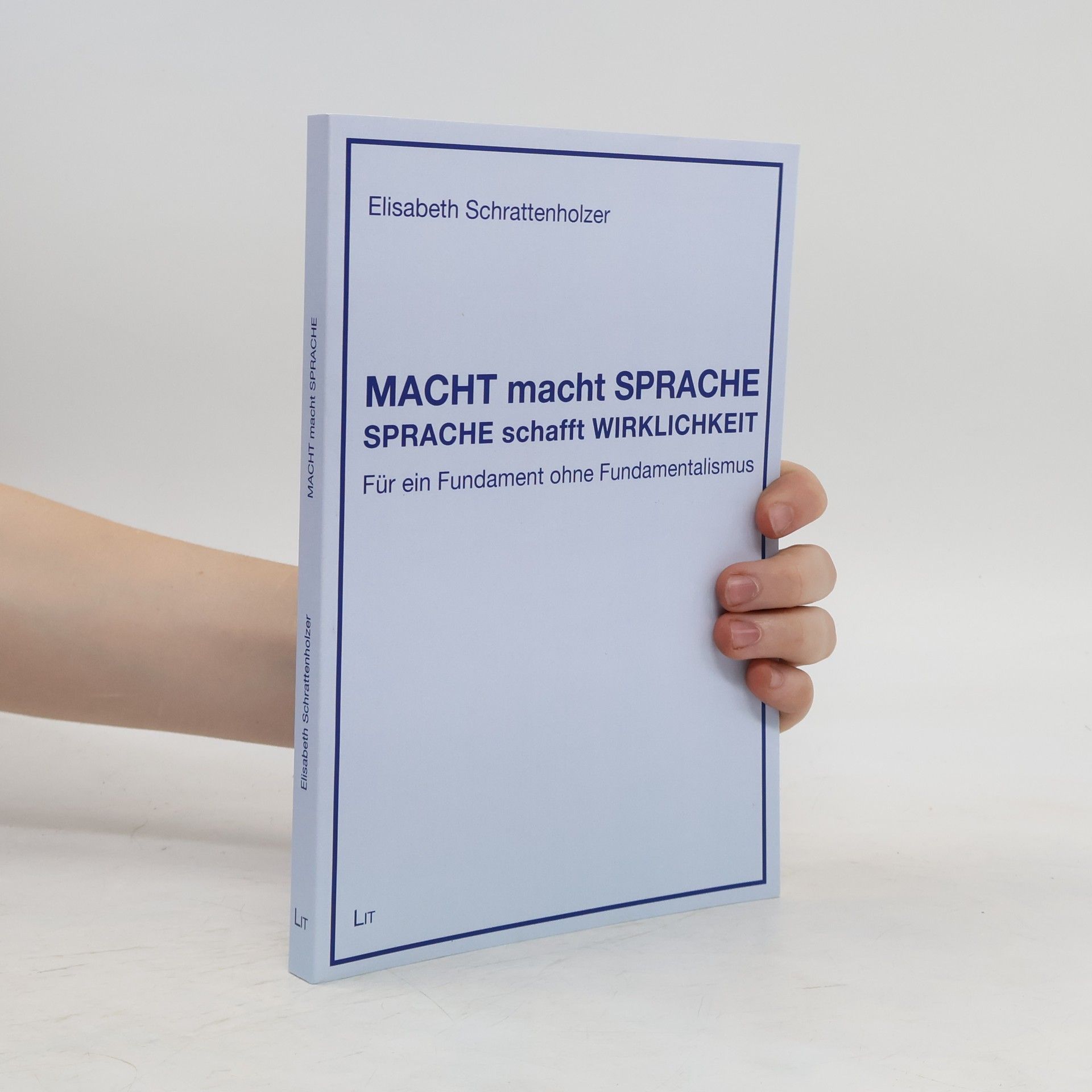
„Ich habe solche Angst, dass alles aus ist zwischen uns. Thomas! Ich will, dass du mich verstehst! Es kann mit uns nur weitergehen, wenn du mich verstehst“. Petra ist verzweifelt, dass Thomas im Bett den Unterschied zwischen eine Nummer abziehen und Liebe abstreitet. Was andere eine Auszeit nennen, nützt sie intensiv, um sich mit ihrer Beziehung zu Thomas zu befassen. Sie schreibt ihm einen Brief, den er aber vielleicht niemals zu lesen bekommen wird, so offen redet sie darin über ihre Vergangenheit. Ihr Bemühen um Klärung führt sie nicht nur zeitlich, sondern auch geografisch weit fort: von der eisbedeckten Donau bis nach Jordanien in die 2000 Jahre alte Stadt, die denselben Namen trägt wie sie selbst, Petra.
Sorry, Nathan!
Wortblind und sinntaub: Die Beschädigung des Denkens durch die Sprache des Patriarchats - Analysen, Betrachtungen, Gegenwehr
Wenn unsere Sprache nicht präzise ist, wie kann unser Denken zu korrekten Ergebnissen gelangen? Und ohne korrekte Ergebnisse, wie können wir Pläne für die Zukunft entwickeln? Die Autorin untersucht drei Stränge: Erstens, wie Begriffe unser Denken leiten und oft einengen. Zweitens, wie falsche sprachliche Abbildungen Verwirrung stiften und uns in eine hörige Haltung drängen. Drittens, wie die Gewöhnung, Worte nicht wörtlich zu nehmen, dazu führt, dass wir inhaltliche Fehler übersehen. Ein Beispiel ist die Toleranz, die oft als erstrebenswert gilt. Doch möchte jemand hören: „Ich toleriere dich!“? Was sagt das über die Sprache aus? Welche Formen fördern Klarheit, welche führen zu Verwirrung? Der generalisierende Singular lädt zu Vorurteilen ein, während unlogische Mehrzahlformen weibliche Identitäten ausblenden. Diese sprachlichen Formen können gefährlich sein, da sie das Denken von der Realität ablenken. Wenn beispielsweise Ausländer pauschal als Feinde betrachtet werden, geschieht dies durch eine verzerrte Sichtweise. Selbst die Toleranzfigur Nathan aus Lessings Werk erweist sich bei genauer Betrachtung als problematisch. Die Autorin fordert eine Anerkennung der Realität in der Sprache und regt dazu an, Worte zu wählen, die als Ausgangspunkt für eine neue Wirklichkeit dienen können.