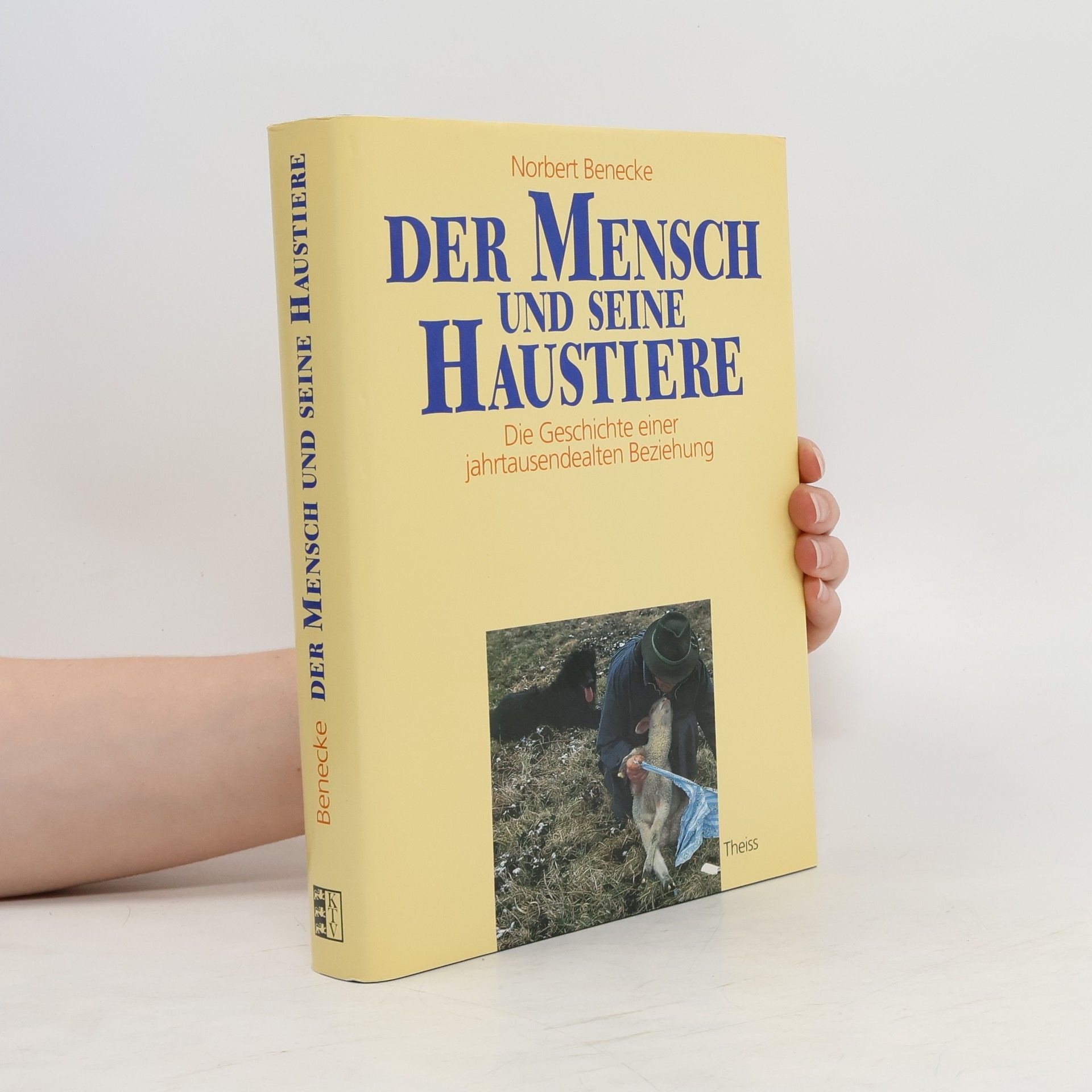Das Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie (ZIAGA) und das Deutsche Archäologische Institut (DAI)
Erinnerungen und Berichte aus der Vor- und Nachwendezeit (1975–2010)
- 188 stránek
- 7 hodin čtení
Zum Jahreswechsel 1991/1992 wurde in Folge der deutschen Wiedervereinigung das damalige Zentralinstitut fur Alte Geschichte und Archaologie (ZIAGA) der Akademie der Wissenschaften der DDR aufgelost. Einige seiner Mitarbeiter/innen konnten ihre wissenschaftliche Arbeit am Deutschen Archaologischen Institut fortsetzen. Der 25. Jahrestag dieses Ereignisses war Anlass fur einen forschungsgeschichtlichen Workshop an der Wissenschaftlichen Abteilung der Zentrale am 10. November 2017. Bei diesem Treffen stand die Frage im Vordergrund, welche Impulse das Deutsche Archaologische Institut durch die Ubernahme von Mitarbeiter/innen und Forschungsinfrastruktur (Bibliotheken, Labore) des ZIAGA erhielt. Mehrere Beitrage befassen sich mit den Forschungen und Forschungsmoglichkeiten in den Jahren der Vor- und Nachwendezeit in den verschiedenen archaologischen Disziplinen und Bereichen, u. a. der Klassischen Archaologie, den Forschungen zu Germanen, Romern und Slawen, der Mittelalter-Archaologie, der Aussereuropaischen Archaologie und den Archao-Naturwissenschaften. Erganzt wird der Band durch zwei Beitrage, die sich den Anfangen der Vor- und Fruhgeschichtsforschung an der Berliner Akademie der Wissenschaften sowie personlichen Erinnerungen an das Verhaltnis von Romisch-Germanischer Kommission und ZIAGA in den 1980er Jahren widmen.