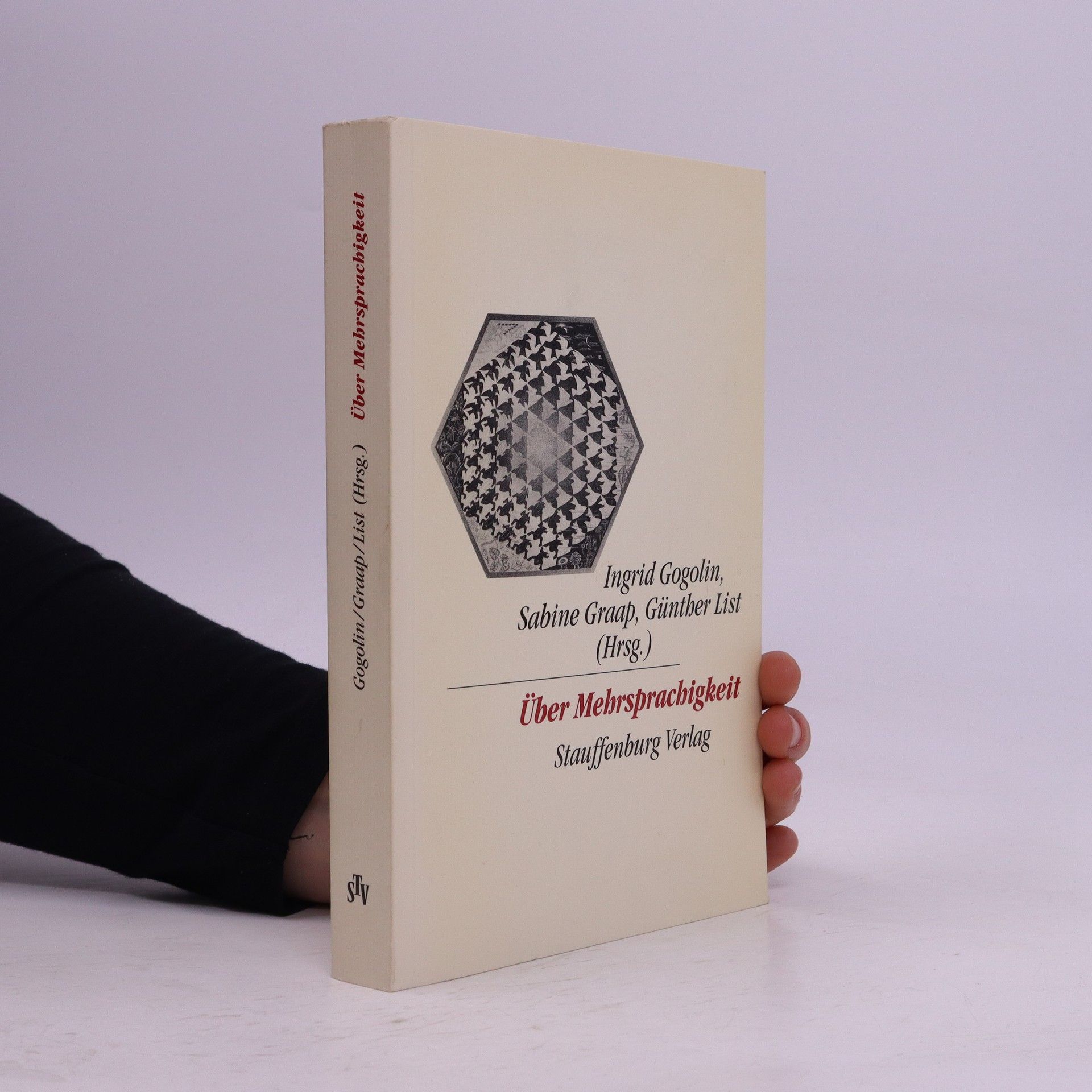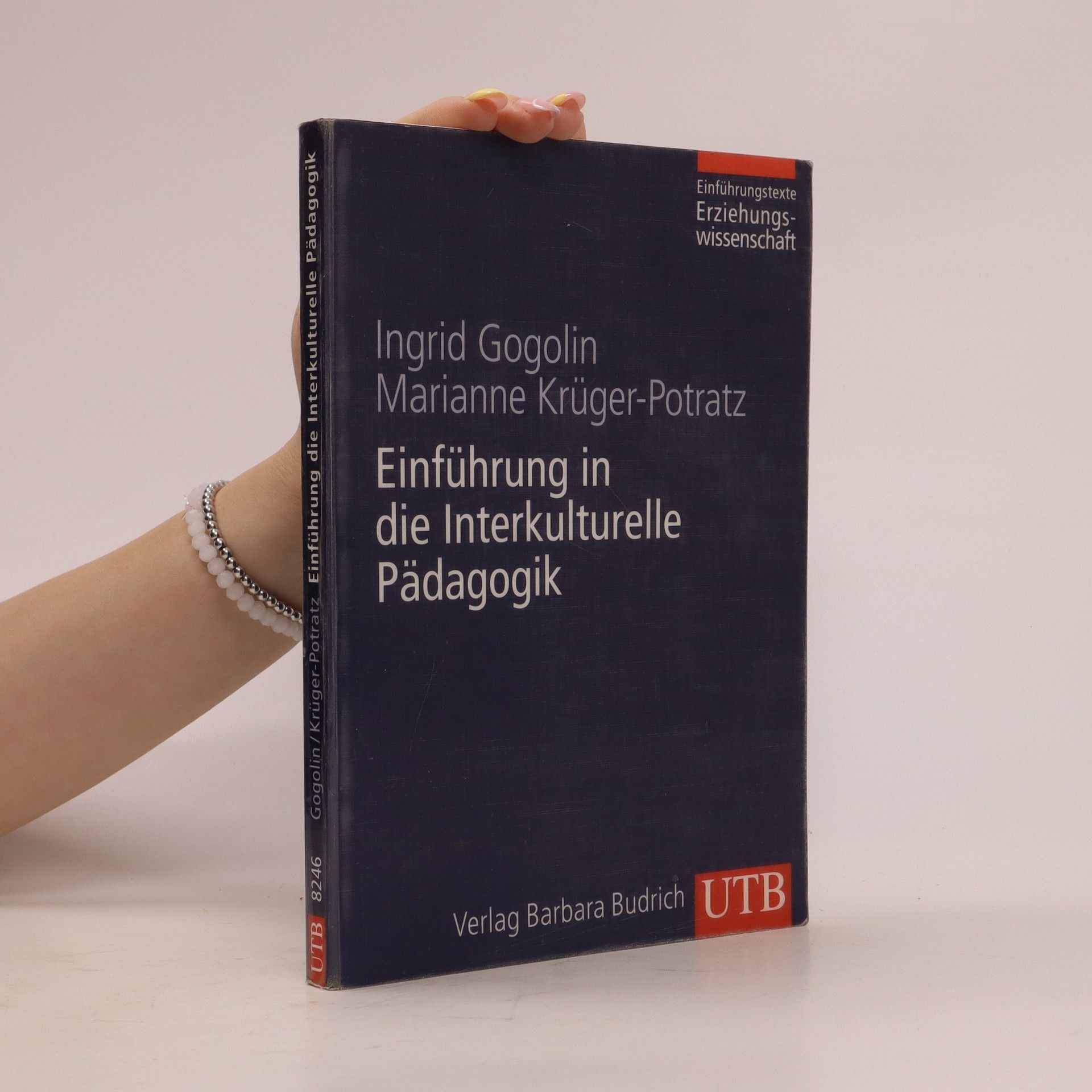Einführung in die interkulturelle Pädagogik
Geschichte, Theorie und Diskurse, Forschung und Studium
Pädagogik als Brückenbauer Deutschland ist ein Einwanderungsland und die Gesellschaft ist multikulturell. Welche Herausforderungen stellt dies an die Pädagogik? In dritter Auflage bietet diese bewährte Einführung einen Überblick über das Aufgabengebiet der Interkulturellen Pädagogik. Vorgestellt werden die Geschichte der Interkulturellen Pädagogik, ihre theoretischen Diskurse und zentralen Forschungsfelder. Zudem erhalten die Leserinnen und Leser einen Überblick über Studienmöglichkeiten sowie Hinweise zur Literaturlage und zum wissenschaftlichen Arbeiten in diesem Bereich. Sie gewinnen somit einen Gesamtüberblick über das komplette Feld der Interkulturellen Pädagogik, das aktueller ist denn je.