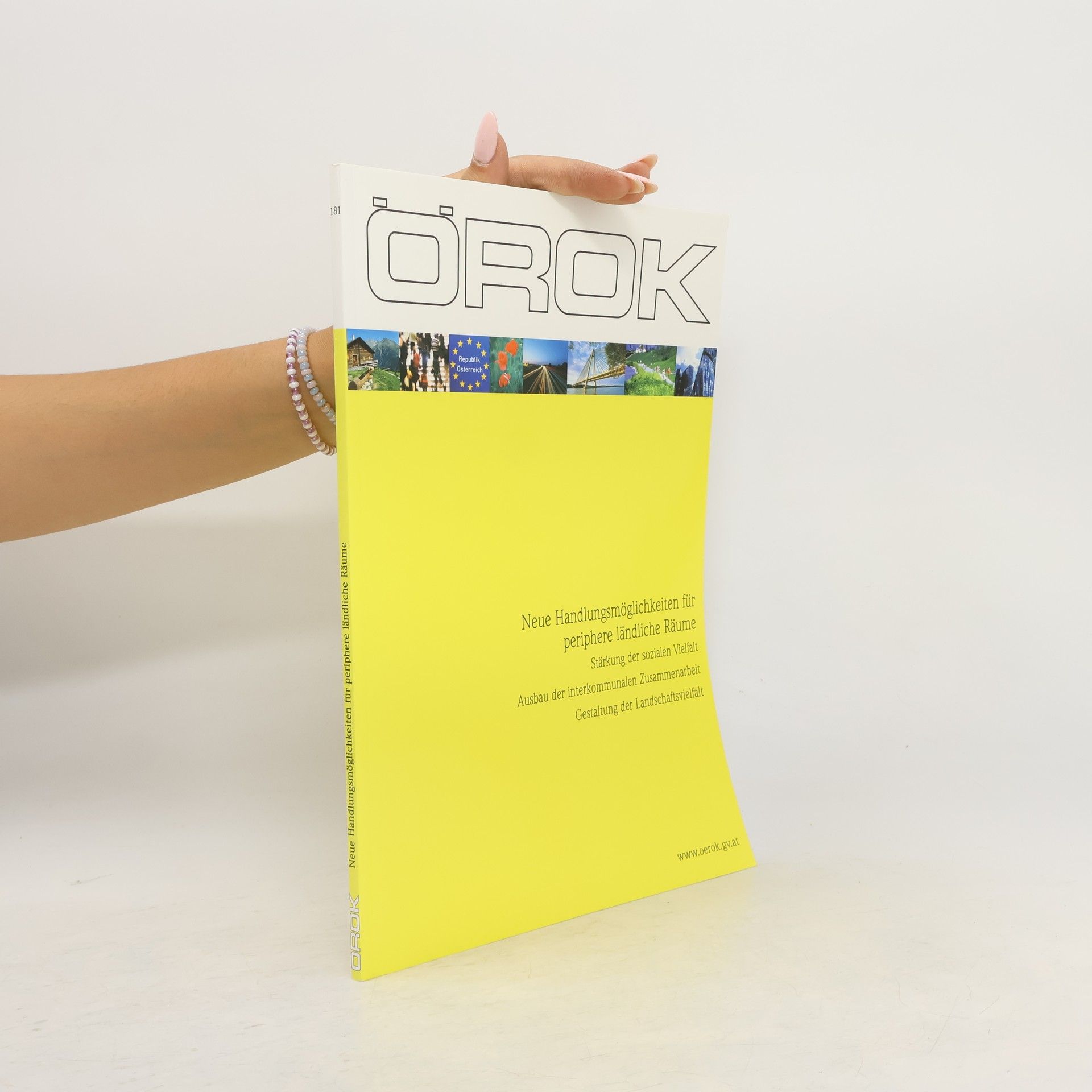Der vorliegende ExpertInnenbericht ergänzt die Ergebnisse des Projekts „Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit ländlicher Räume“ und zeigt neue Handlungsmöglichkeiten für periphere ländliche Räume auf. Im Rahmen des ÖROK-Projekts wurde gezielt der Raumtyp der peripheren ländlichen Räume fokussiert. Die inhaltlichen Schwerpunkte lagen auf den Themen „Soziale Vielfalt“, „Kooperation“ und „Landschaftsentwicklung“, die als wesentliche Ansatzpunkte identifiziert wurden und für die ein Bedarf an weiterer Information und Bewusstseinsbildung besteht. Ziel des Projekts war es, Kommunikationsprozesse anzuregen und eine Plattform für eine vertiefende Diskussion über ausgewählte Problemlagen im ländlichen Raum zu bieten. Zudem sollten „Mythen und Tabus“ zu peripheren ländlichen Räumen angesprochen werden, wobei nicht nur eine distanzierte Expertenperspektive, sondern auch der Dialog mit regionalen EntscheidungsträgerInnen und Personen mit besonderen Beziehungen zu diesen Gebieten einbezogen wurde. Darüber hinaus wurden gute Praxisbeispiele aus dem In- und Ausland gesammelt, die Lösungsansätze für periphere ländliche Räume bieten können. Den Abschluss bilden Handlungsempfehlungen des Bearbeitungsteams.
Thomas Dax Knihy