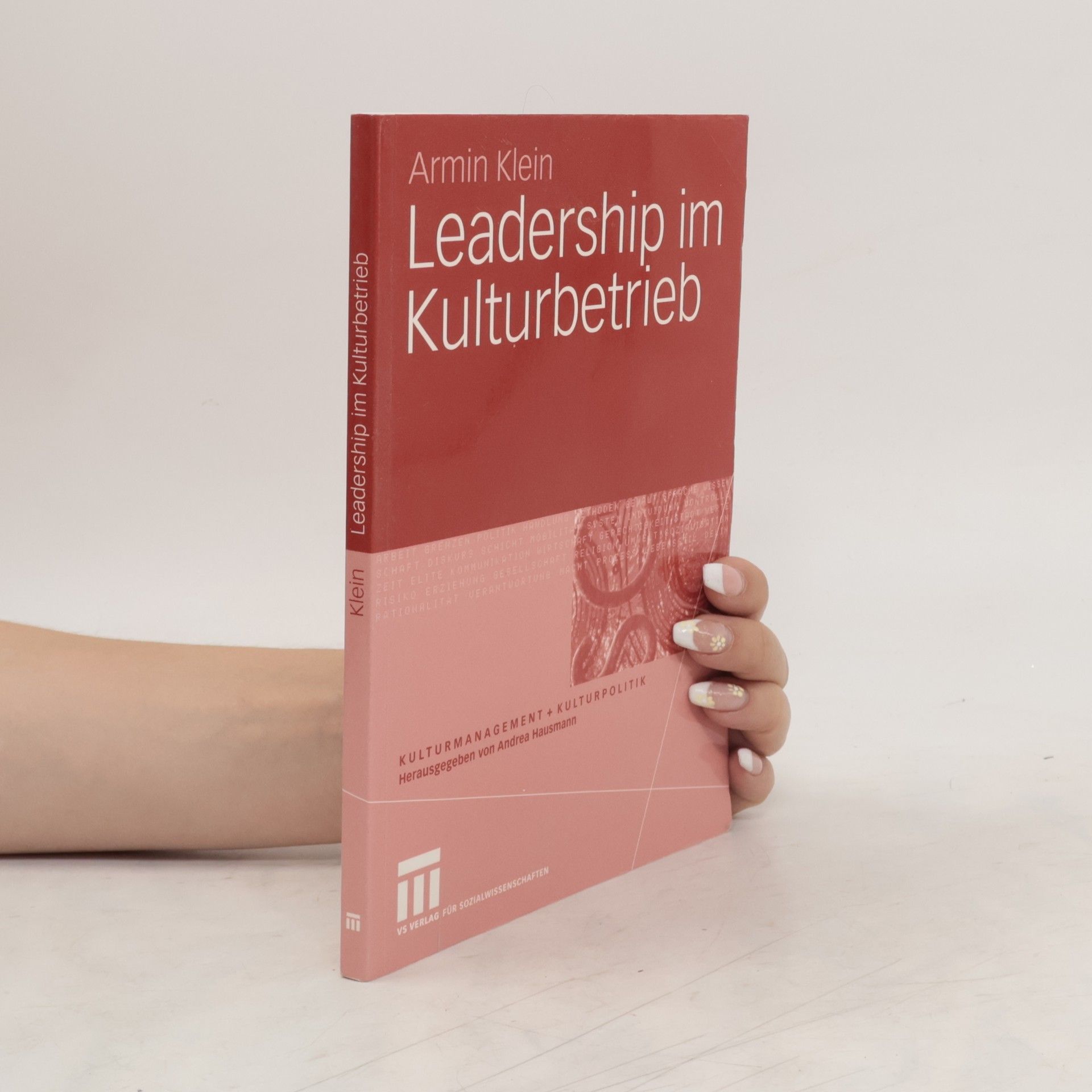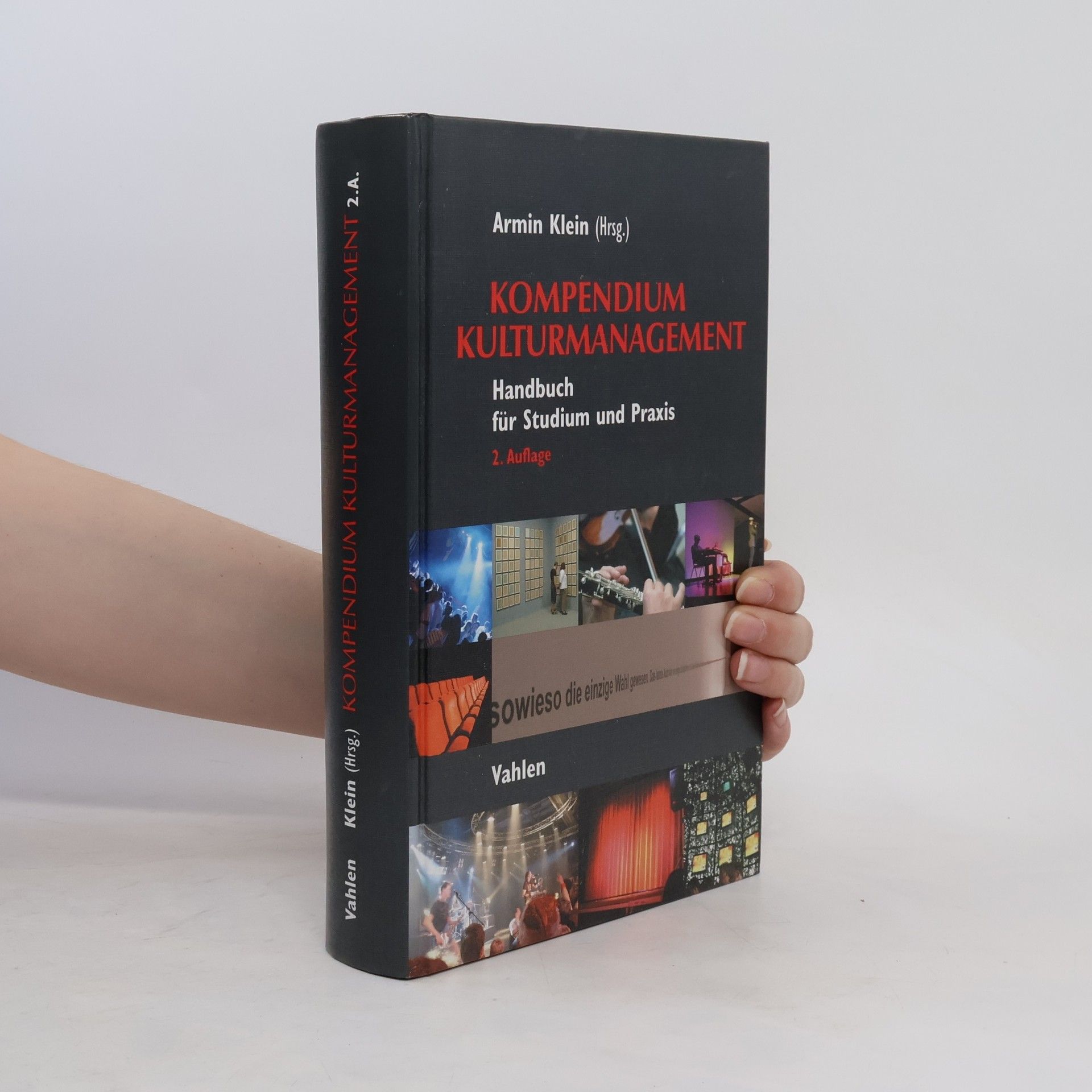Kulturpolitik hat in den letzten Jahrzehnten ständig an Bedeutung gewonnen. Wie aber funktioniert sie, unter welchen Rahmenbedingungen findet sie statt? Das Buch klärt die Grundbegriffe: Welche Konzepte von Kultur werden im Zusammenhang der Kulturpolitik diskutiert, was wird unter Kultur, was unter Politik, was schließlich unter Kulturpolitik verstanden?
Armin Klein Knihy
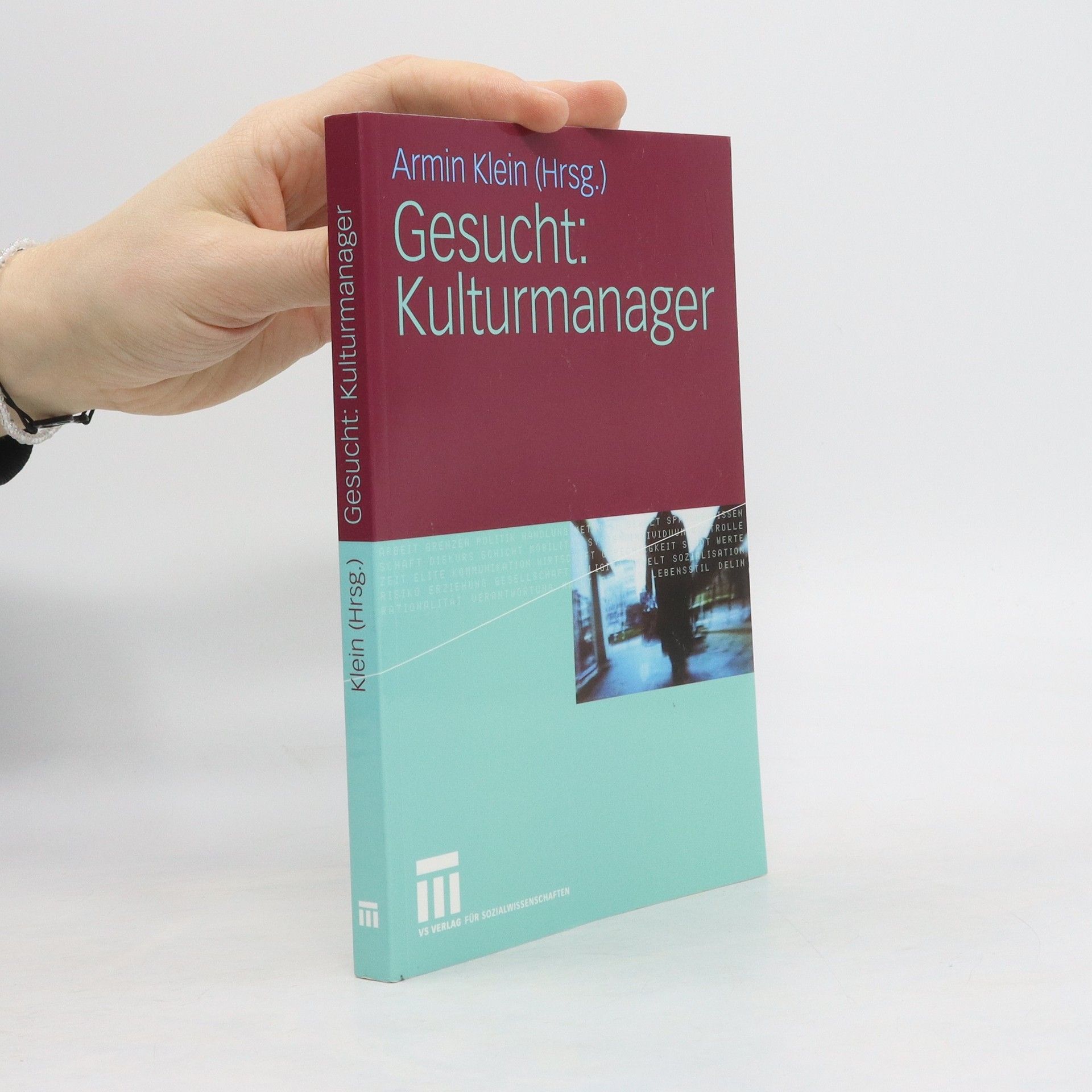
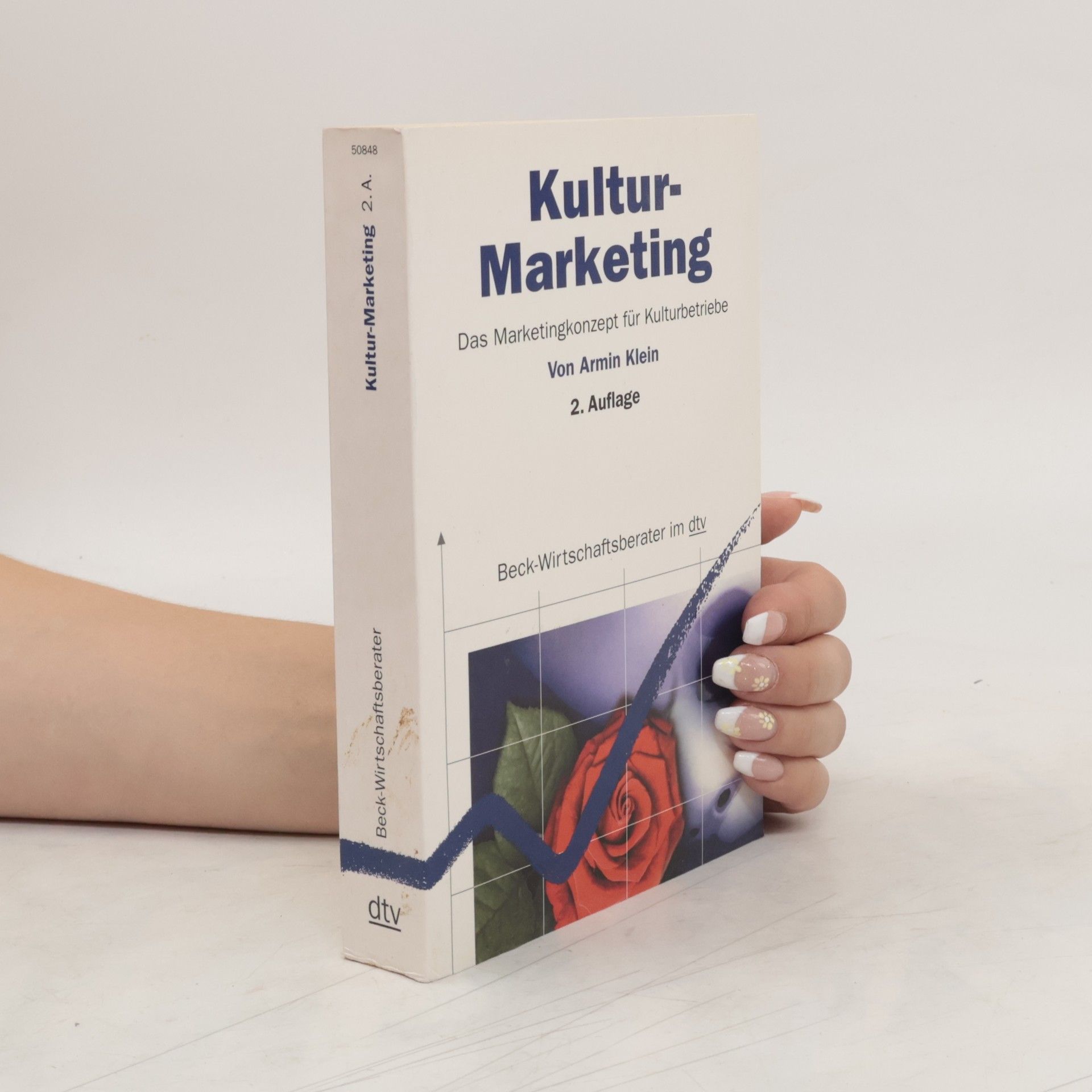

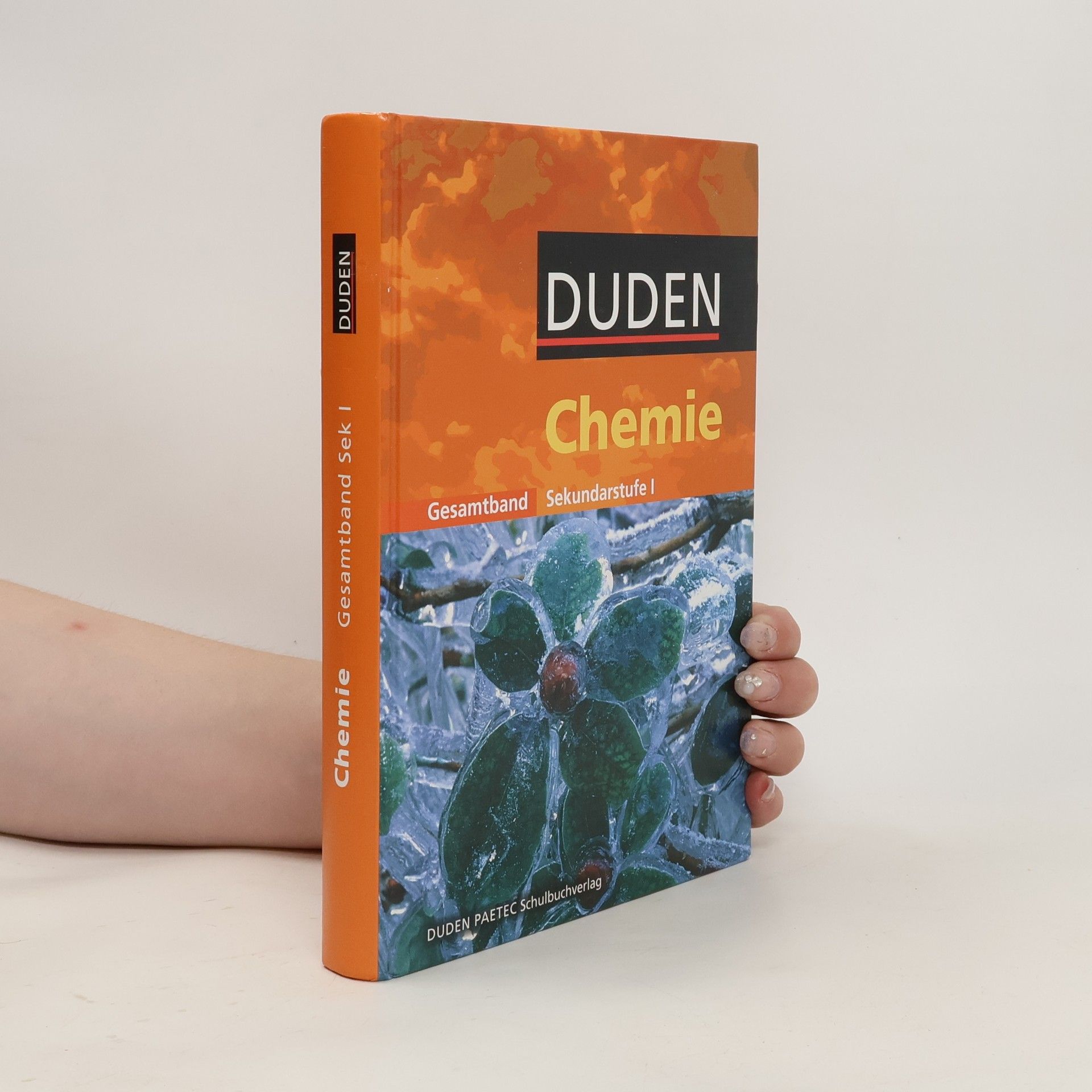


Markus Lüpertz ist seit rund 60 Jahren als Künstler aktiv und hat seine Karriere als Maler begonnen, bevor er sich auch der Dreidimensionalität zuwandte. Seit den 1980er Jahren ist das Arbeiten mit Ton ein fester Bestandteil seines Schaffens, inspiriert durch Begegnungen mit Künstlern wie Eduardo Chillida und Hans Spinner. Lüpertz' künstlerisches Schaffen zeichnet sich durch eine figürliche Herangehensweise aus, die in einer Zeit, in der Gegenständlichkeit verpönt war, neue Motive für die zeitgenössische Kunst erschloss. Seine Malerei diente ihm als Prozess der Selbstfindung, wobei figürliche Elemente in abstrakte Zeichen transformiert wurden. Dies übertrug er auch auf die Plastik, was zu Neuinterpretationen historischer und mythologischer Figuren führte. Lüpertz schafft einen eigenen Kosmos, in dem er historische Vorlagen bearbeitet und ironisiert, um die menschlichen Darstellungen seit der Antike auf ihre Relevanz zu prüfen. Seine Skulpturen erweitern die Grenzen der Malerei, insbesondere durch den Einsatz von Farbe. Ein herausragendes Beispiel sind die 14 Großkeramiken, die er für die Karlsruher U-Bahn zwischen 2019 und 2022 schuf. Diese Werke, bestehend aus 140 Keramikplatten, sprengen die Dimensionen des Keramischen und setzen sich von der umgebenden Architektur ab. Sie verbinden antike Referenzen mit mythologischen Themen und bilden eine eigene Schöpfung, die Lüpertz' künstlerisches Universum reflektiert.
Das Lehrbuch behandelt die zentralen Lernbereiche des Chemieunterrichts in der Sekundarstufe I und macht die Chemie durch Alltagsbezüge und Experimente erlebbar. Es ist klar strukturiert und fördert einen abwechslungsreichen Unterricht. Die Themen umfassen Stoffe und Eigenschaften, Metalle, Luft, Wasser, Atombau, Redoxreaktionen, quantitative Betrachtungen, Säuren und Basen, Salze sowie organische und anorganische Kohlenstoffverbindungen. Das Buch bietet handlungsorientierte Gestaltung durch Projekte, Praktika und Experimente, die den Schülern helfen, Denk- und Arbeitsweisen zu entwickeln. Vielfältige Aufgaben vertiefen und wenden das Wissen an. Ein Abschlusskapitel dient der Wiederholung und Systematisierung der Inhalte. Die Kapitel beinhalten praktische Anwendungen, wie das Trennen von Stoffgemischen, Experimente mit Kerzen, die Chemie des Wassers, und die Untersuchung von Metallen im Alltag. Weitere Themen sind die Eigenschaften von Säuren und Basen, die Bedeutung von Kohlenstoffverbindungen, und die Chemie von Naturstoffen und Kunststoffen. Praktische Experimente zu Alkoholen, Lebensmitteltests und Seifen runden das Angebot ab. Insgesamt bietet das Buch eine umfassende Grundlage für den Chemieunterricht und fördert das Interesse der Schüler an naturwissenschaftlichen Themen.
In diesem ersten Band wird das zentrale Projekt vorgestellt, das die Protagonisten in eine spannende und herausfordernde Welt führt. Die Handlung entfaltet sich durch komplexe Charaktere, die mit persönlichen und gemeinschaftlichen Konflikten konfrontiert sind. Themen wie Freundschaft, Loyalität und der Kampf gegen Widrigkeiten stehen im Vordergrund. Der Leser wird in eine fesselnde Erzählung hineingezogen, die sowohl emotionale als auch intellektuelle Anreize bietet und einen vielschichtigen Blick auf die Herausforderungen der Charaktere wirft.
Kulturbetriebe benötigen heute mehr denn je ein effizientes Marketing, um in der Erlebnisgesellschaft ihr Publikum zu finden und nachhaltig ihren Bestand angesichts immer knapper werdender öffentlicher Mittel sicherzustellen. Das Buch beschreibt anhand vieler praktischer Beispiele Schritt für Schritt ein strategisches Kulturmarketingkonzept, das den Primat der künstlerischen bzw. kulturellen Zielsetzung in den Mittelpunkt stellt. Es richtet sich in erster Linie an Praktiker in Kulturbetrieben, die für ihre Einrichtung ein effizientes Marketingkonzept entwickeln wollen und an Studierende des Faches Kulturmanagement, die in Zukunft im Kulturbetrieb arbeiten werden.
Gesucht: Kulturmanager
- 230 stránek
- 9 hodin čtení
Welche Kulturmanager braucht der Markt? Diese Frage beantwortet das Buch kenntnisreich und auf der Basis von umfangreichen Recherchen. Es wurden etwa 40 Leiter von Kultureinrichtungen befragt und zudem eine umfangreiche Umfrage zum Thema erhoben: Auf diese Weise gelingt eine Darstellung von Berufsanforderungen und Berufsaussichten für alle (angehenden) Kulturmanager.
Leadership im Kulturbetrieb
- 153 stránek
- 6 hodin čtení
Angesichts der Globalisierung und ihrer Chancen und Risiken stehen auch die Kulturbetriebe in Deutschland vor ganz neuen Herausforderungen. In diesem Modernisierungsprozess sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das wichtigste Potenzial der Kultureinrichtung. Die Aufgabe eines entsprechenden Leaderships im Kulturbetrieb besteht darin, seine Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, gemeinsam exzellente Leistungen zu vollbringen. Leadership wird dabei aus einer systemischen Sicht verstanden: Es geht also nicht länger um die ideale Führungstheorie und die herausragende „Führungsfigur“, sondern um das möglichst gute Zusammenspiel der Einzelnen innerhalb des Systems Kulturorganisation und das nur gemeinsam zu konstruierende Selbstverständnis und Leitbild eines Kulturbetriebs. Leitvorstellung dabei ist der “lernende Kulturbetrieb“, dessen einzelne Mitglieder zunehmend in die Lage versetzt werden sollen, mit den neuen Herausforderungen offensiv umzugehen und diese zu ihren Gunsten zu gestalten, Risiken zu erkennen und Chancen zu nutzen.
Der exzellente Kulturbetrieb
- 336 stránek
- 12 hodin čtení
Kultureinrichtungen in Deutschland befinden sich in einer doppelten Krise: einerseits wird die Finanzierung durch Bund, Länder und Kommunen immer unsicherer, andererseits fehlt es an langfristiger strategischer Ausrichtung. Das Buch gibt kompetent und deutlich Antworten auf diese Krisensituation und zeigt Wege für die Zukunft auf.
In den letzten zehn bis fünfzehn Jahren entstanden im deutschsprachigen Raum mehr als 50 Ausbildungseinrichtungen für Kulturmanagement. Seither hat das Fach eine Konsolidierungsphase durchlaufen, wodurch jetzt solides und relativ beständiges Grundwissen für Ausbildung und Praxis zur Verfügung steht. Das Kompendium Kulturmanagement bündelt dieses Wissen für Lehrende, Studierende und Praktiker in Kultureinrichtungen. Das Kompendium Kulturmanagement bündelt das Wissen des Kulturmanagements für Lehrende, Studierende und Praktiker. - Kulturmanagement - Einführung - Kultursponsoring - Kulturökonomik - Managementtechniken - Öffentlichkeitsarbeit - Rechnungslegung - Kulturpolitik - Kulturmarketing - Projektmanagement - Fundraising - Öffentliche Zuwendungen - Recht und Rechtsform - Controlling - Die Kosten- und Leistungsrechnung - Merchandising - Kulturjournalismus - Kulturentwicklungsplanung Prof. Dr. Armin Klein lehrt Kulturmanagement und Kulturwissenschaften am Institut für Kulturmanagement in Ludwigsburg. - „. eines der wichtigsten Grund- und Standardwerke.“ - „.“der Klein„ kann das werden, was “der Wöhe„ den BWLern ist.“ - Neuauflage - Für Studium und Praxis - Bachelor geeignet Für Lehrende, Studierende und Praktiker in Kultureinrichtungen.
In Zeiten beschleunigten gesellschaftlichen Wandels lassen sich komplexe Aufgabenstellungen immer weniger mit herkömmlichen Methoden und Mitteln bewältigen. Effizientes Projektmanagement ist deshalb in allen gesellschaftlichen Bereichen das zentrale Instrument, um bei begrenzten Ressourcen bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Das Buch stellt daher die Grundzüge des Projektmanagement im Kulturbereich dar, erläutert die einzelnen Instrumente und verdeutlicht an zahlreichen Praxisbeispielen, wie sie richtig eingesetzt werden.