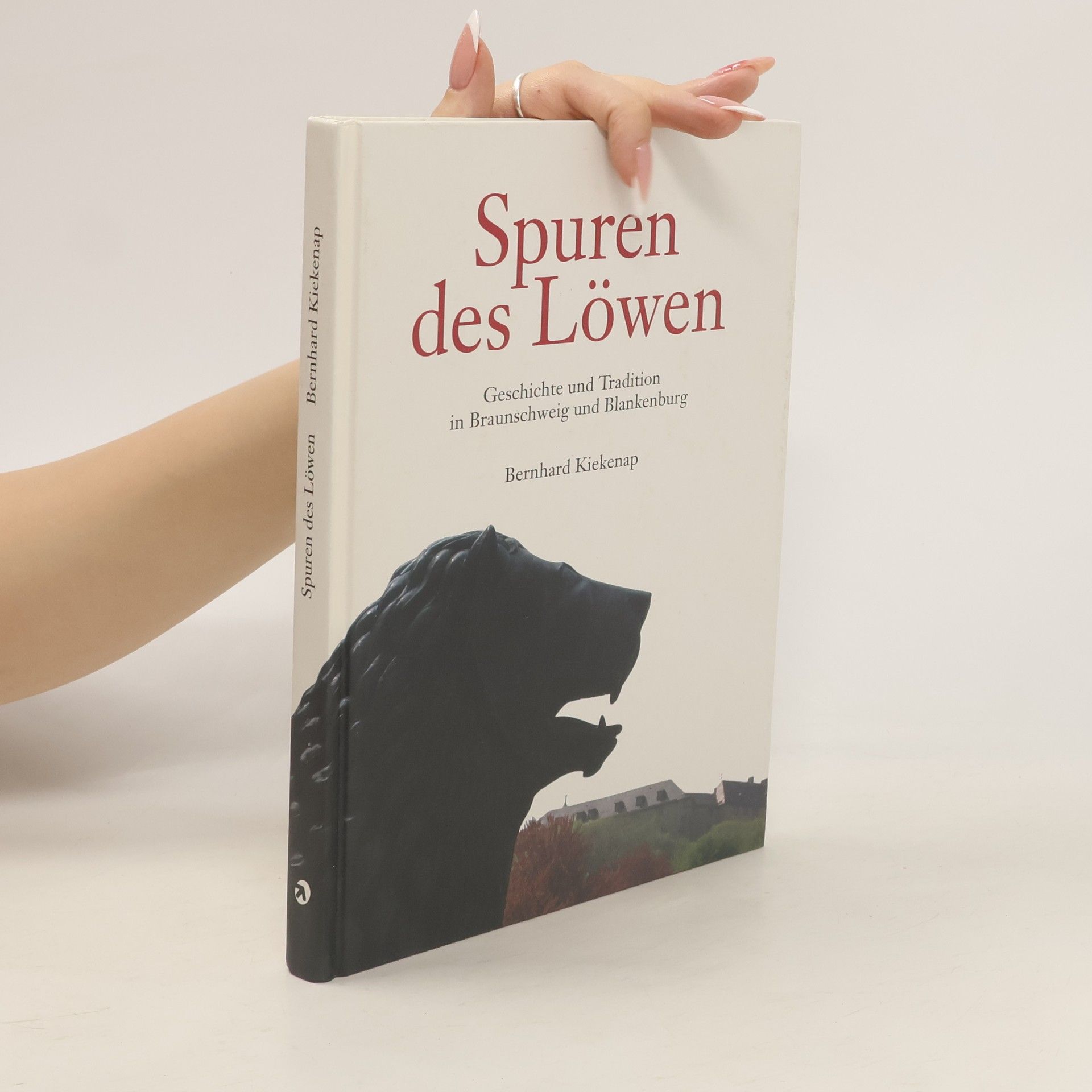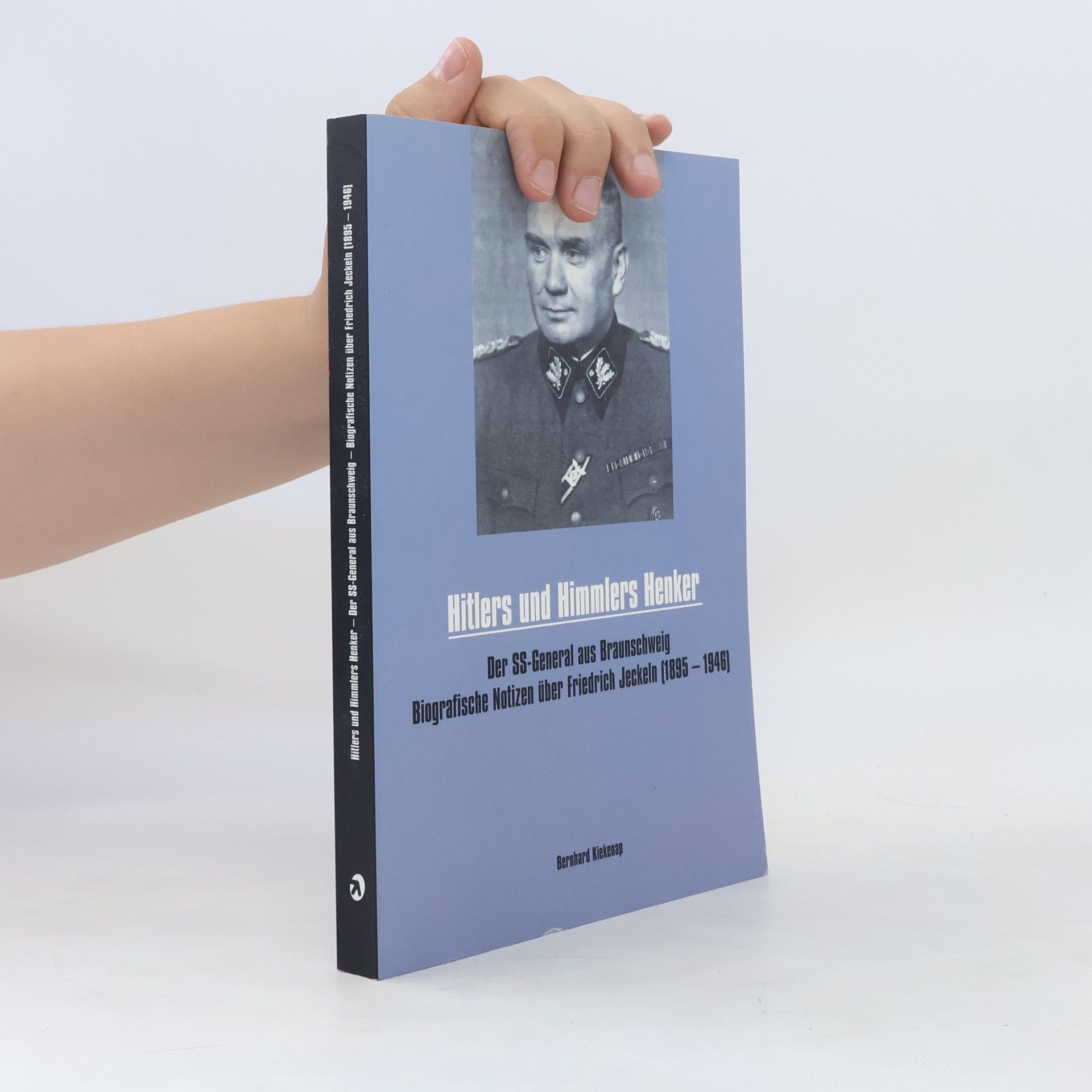Hitlers und Himmlers Henker
- 188 stránek
- 7 hodin čtení
Nach Ruhe und Ordnung sehnten sich viele Braunschweiger Bürger, nachdem die Nazis am 30. Januar 1933 reichsweit die Macht übernommen hatten. Viele waren der ständigen Kämpfe zwischen Nationalsozialisten und Marxisten überdrüssig. Aber die Hoffnung war vergebens: Allein im Jahre 1933 gab es in Braunschweig 34 politische Morde – und das „Terror Trio“ Klagges, Alpers und Jeckeln war nicht nur überwiegend der Anstifter sondern verhinderte auch die Aufklärung der Verbrechen. Die Braunschweiger Justiz spielte dabei eine überaus unrühmliche Rolle.