Ulrich Kadelbach Knihy


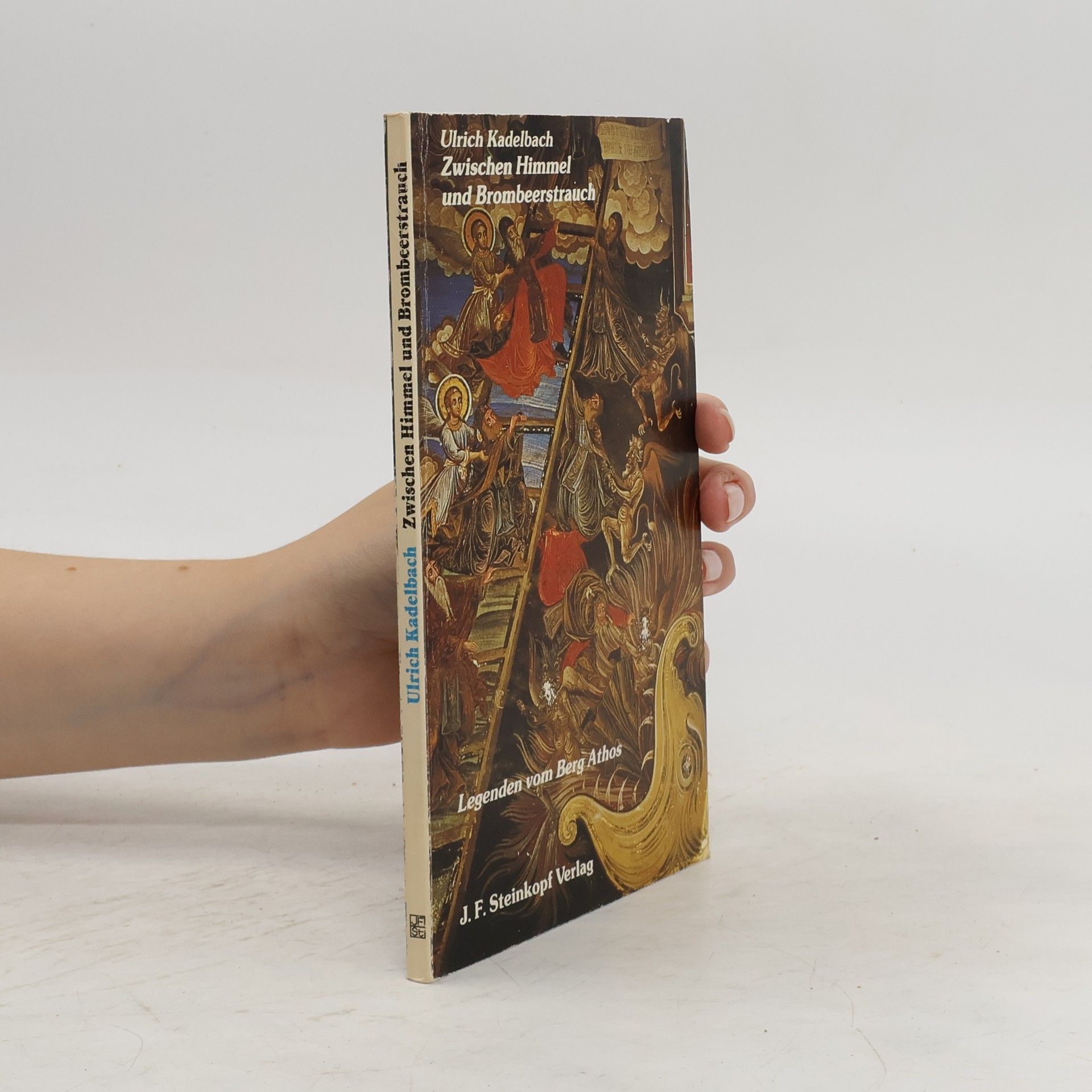
Die Betroffenheit über den Ukrainekrieg irritiert Gedanken, Weltanschauungen und Glauben. Die Russische Orthodoxe Kirche, insbesondere deren Patriarch Kyrill, stellt die Rolle christlichen Handelns grundsätzlich in Frage. Ein dunkler Schatten legt sich über jegliches Vertrauen in den Auftrag der Kirchen, hier vornehmlich der orthodoxen. Damit diese darüber nicht generell in Misskredit geraten, möchte ich deren großen geistlichen Reichtum in Erinnerung rufen, von dem die westlichen Kirchen so viel profitieren. Zum einen ist der erste Impuls zur Gründung des Ökumenischen Weltrats der Kirchen vom Orthodoxen Patriarchat in Konstantinopel ausgegangen, zum anderen ist den westlichen Kirchen die Bedeutung der Lehre vom Heiligen Geist wieder neu ins Bewusstsein gebracht worden. Viele große evangelische und katholische Theologen bekennen in diesem Zusammenhang die „Geistvergessenheit“ des Westens. So ist nach westlichem Verständnis die Kirche christologisch als „Leib Christi“ zu verstehen. Die Orthodoxie aber sieht die Kirche als Werk des Heiligen Geistes, mithin als „Gemeinschaft der Heiligen“ an. Ein künftiger Austausch darüber steht an.
Schatten ohne Mann
Die deutsche Besetzung Kretas 1941-1945
Jahr für Jahr reisen unzählige Touristen nach Kreta. Kaum einer von ihnen weiß etwas von der deutschen Besatzung und den Kriegsverbrechen auf der Insel. Viele Wunden sind vernarbt. Noch aber wirft die Trauer lange Schatten. Die herzliche Gastfreundschaft der Kreter und ihre Bereitschaft zu Vergebung und Versöhnung sollten nicht dazu verleiten, dieses dunkle Kapitel deutsch-griechischer Geschichte möglichst rasch zu überblättern. Kaum einer der Verursacher der langen Schatten hat sich zu seiner Verantwortung bekannt. Ein neues Europa aber kann nur dann aufgebaut werden, wenn auch der Untergrund erforscht und von vergiftenden Altlasten befreit wird. Die Begegnung mit Betroffenen und die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte werden vom Autor durch unveröffentlichte NS-Dokumente und bundesrepublikanische Gerichtsprotokolle zu einer tagebuchartigen Textcollage verknüpft.