Manfred Füllsack Knihy
1. leden 1960
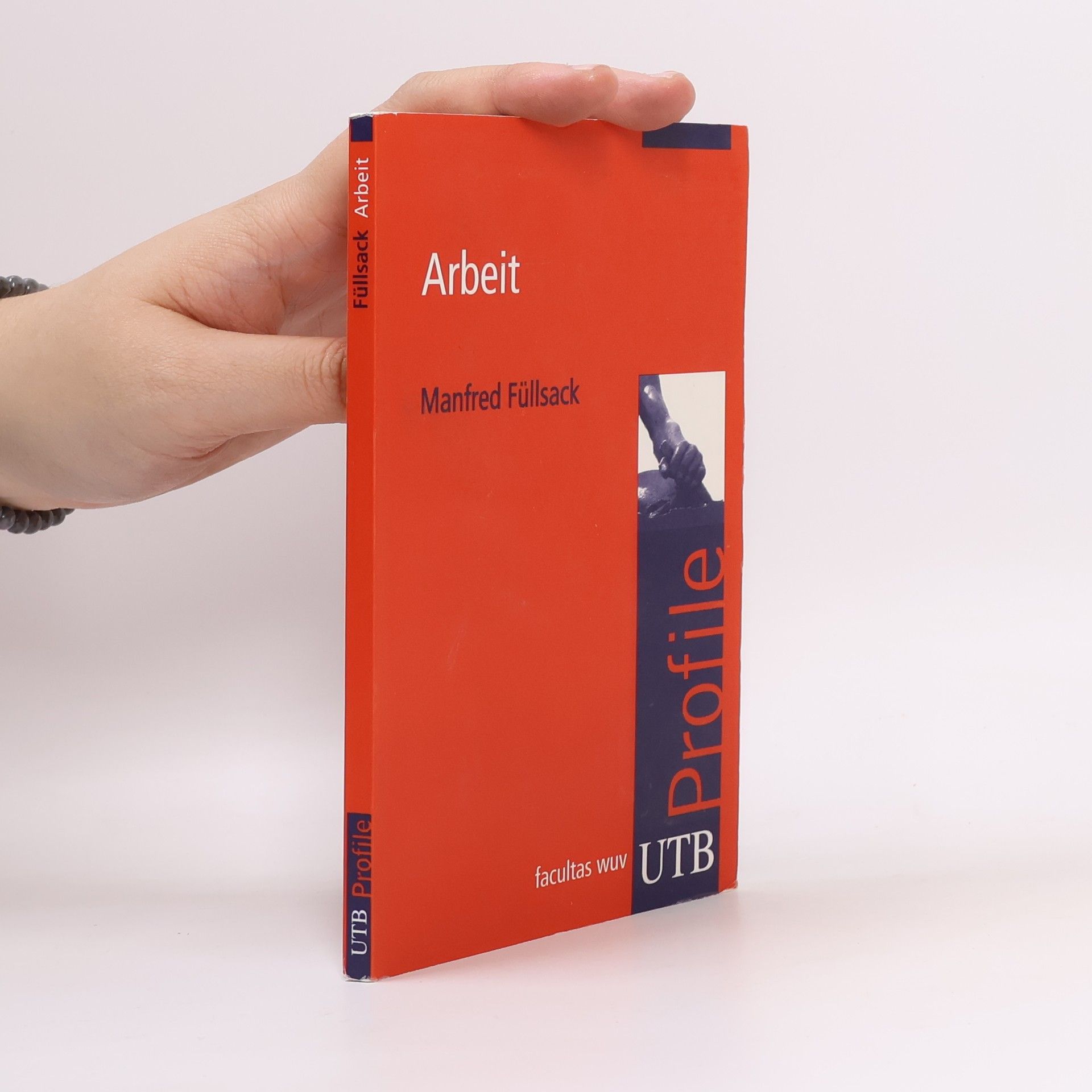

Arbeit
- 118 stránek
- 5 hodin čtení
Der Band erkundet das Phänomen „Arbeit“ im Hinblick auf seine historischen, sozialwissenschaftlichen, ökonomischen und philosophischen Aspekte. Im Mittelpunkt steht dabei der Wandel der Arbeit und seine Bedeutung für die zeitgenössische Gesellschaft. Es werden Grundlagen bereitgestellt, um über die aktuelle Situation der Arbeit, ihre Aufgabe, ihren Sinn und die Möglichkeiten ihrer zukünftigen Gestaltung nachzudenken.