Arbeit als Lebensstil
- 211 stránek
- 8 hodin čtení
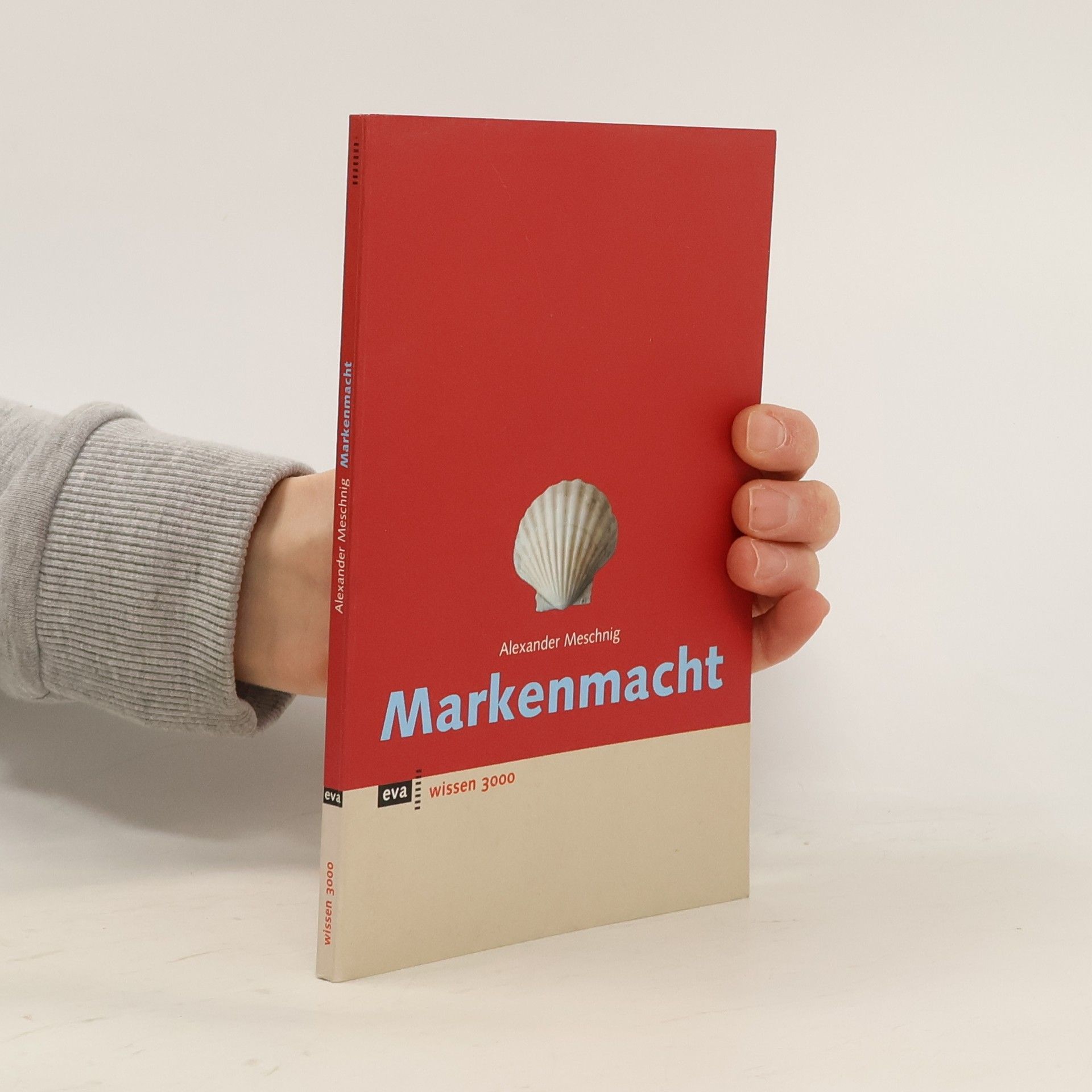
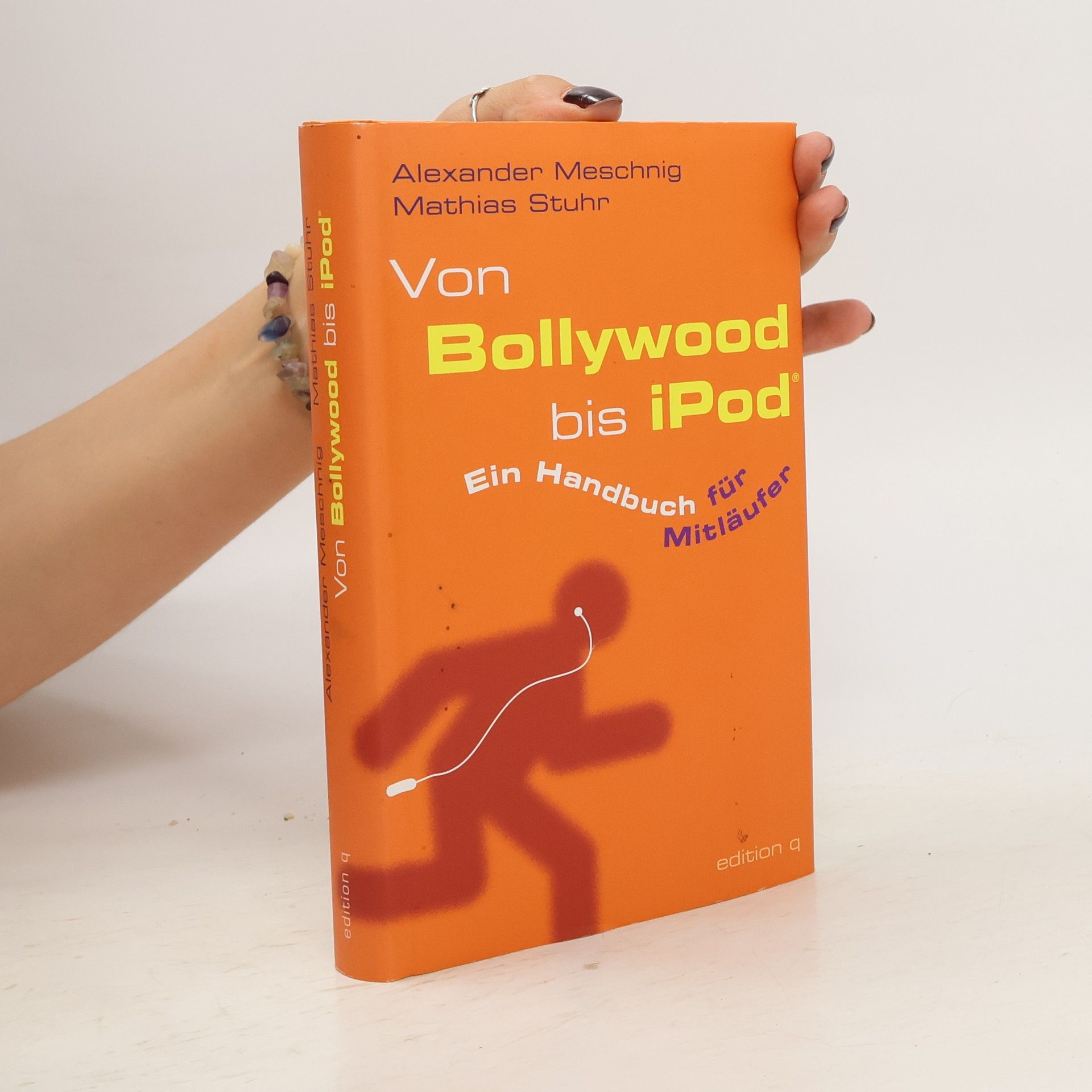

Wir kennen sie alle: Menschen, die jeden Unsinn mitmachen, weil es im Fernsehen kam oder weil Nachbarn und Kollegen davon erzählt haben. Dieses Handbuch wirft einen Blick auf den ganz normalen Mitläufer. Der tatsächlich mitrennt, wenn Gehen mit Stöcken plötzlich 'Nordic Walking' heißt, der Fangopackungen eklig fand und Sauna langweilig, aber jetzt ganz auf 'Wellness ' schwört. Der das 'Web 2.0' für aufregend hält und sich im 'Second Life' herumtreibt, obwohl er schon im ersten Leben nicht weiß, was er da soll.
Markenstrategien sind heute allgegenwärtig, Markenbotschaften durchdringen unseren Alltag („Ich bin doch nicht blöd.“). Marken werden verehrt („geile Nike-Schuhe sind ein Muss“) und gehasst (No logo!). Die Schaffung von „Markenpersönlichkeiten“ geht weit über den unmittelbaren Produtionsbereich hinaus. Längst haben nicht nur Hautcremes, Kaffees und Autos Markenpersönlichkeiten, sondern auch Verlage, Stadtverwaltungen oder Bundesländer („Wir können alles, außer Hochdeutsch“). eva wissen verarbeitet die aktuelle Diskussion um Titel von Sennett, Rifkin, Weiss und Klein. Es ist mit leichter Hand geschrieben dabei anspruchsvoll und clever.