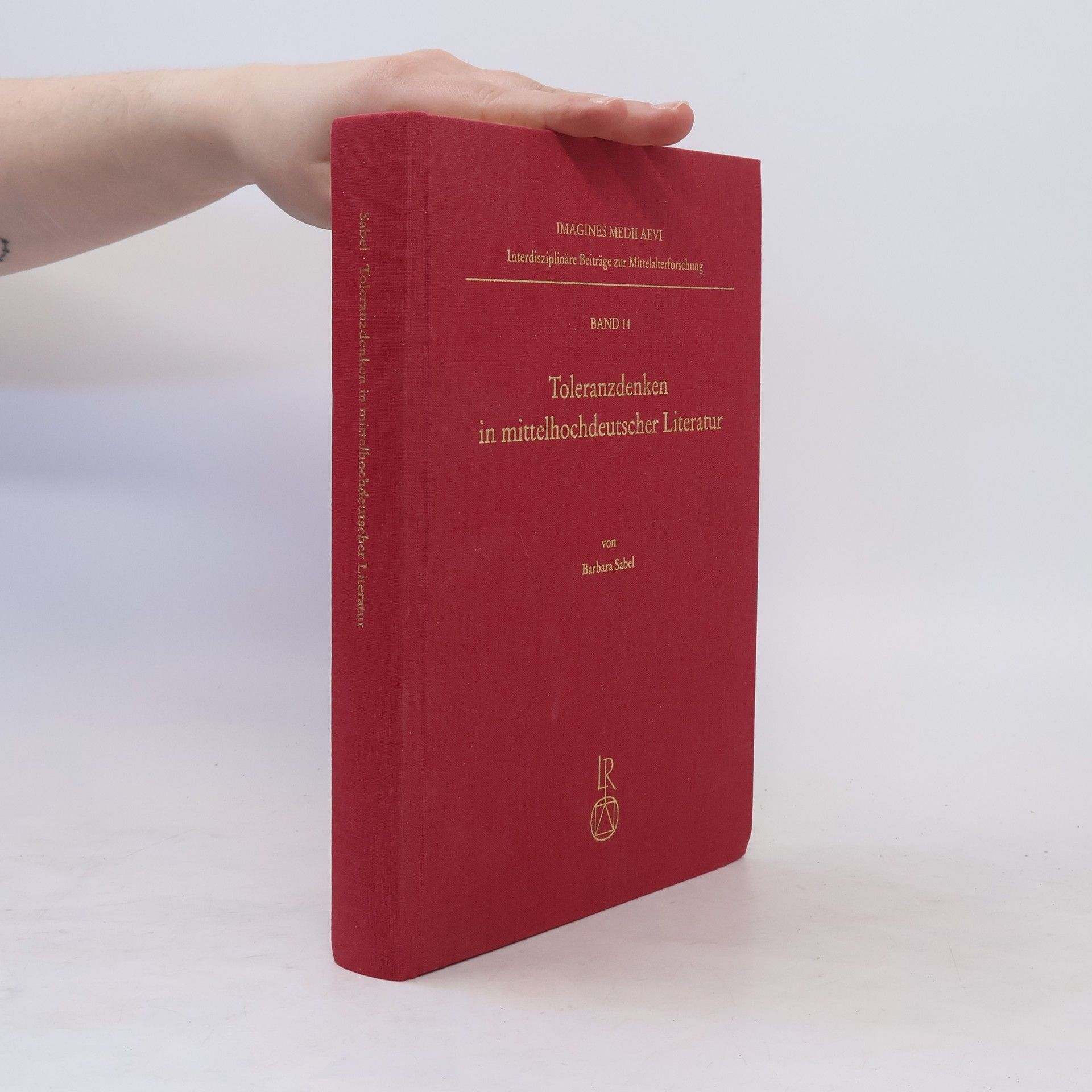Gab es im Mittelalter Toleranz als Thema der Theologie und Literatur? Welche Grundlagen hatte das mittelalterliche Toleranzdenken? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Arbeit. Zunächst wird ein anwendbarer Toleranzbegriff entwickelt und die spezifische Bedeutung des mittelalterlichen Begriffs „tolerantia“ sowie die Toleranznorm und der „Toleranzraum“ untersucht. Im Kontext der Einordnung von Andersgläubigen im 12. bis 14. Jahrhundert wird Wolframs Willehalm als zentrales Werk analysiert. Wolfram illustriert nicht nur Beispiele toleranten Verhaltens, sondern entwirft ein Konzept von Toleranz und Pluralität. Seine Erzähltechnik, die Werte und Perspektiven gegenüberstellt, öffnet Raum für toleranteres Denken. Dennoch propagiert der Willehalm keinen religiösen Wertepluralismus; ethnische und kulturelle Unterschiede werden gewürdigt, während andere Religionen nur geduldet werden. Die Analyse von dreizehn weiteren mittelhochdeutschen Dichtungen und ihren französischen Vorlagen zeigt, dass Wolframs Willehalm zwar nicht das einzige Werk mit Beispielen von religiöser Duldung ist, jedoch in seiner Kritik am Kreuzzugsdenken und der besonderen Achtung vor Andersgläubigen sowie dem umfassenden Konzept der Vielheit bemerkenswert ist. Zudem wird der Einfluss von Entstehungszeit, Gattung und Dichterpersönlichkeit auf die Heidendarstellung betrachtet. Die Analyse verdeutlicht, dass die persönliche Haltung des Dichters entscheidend für die Da
Barbara Sabel Knihy