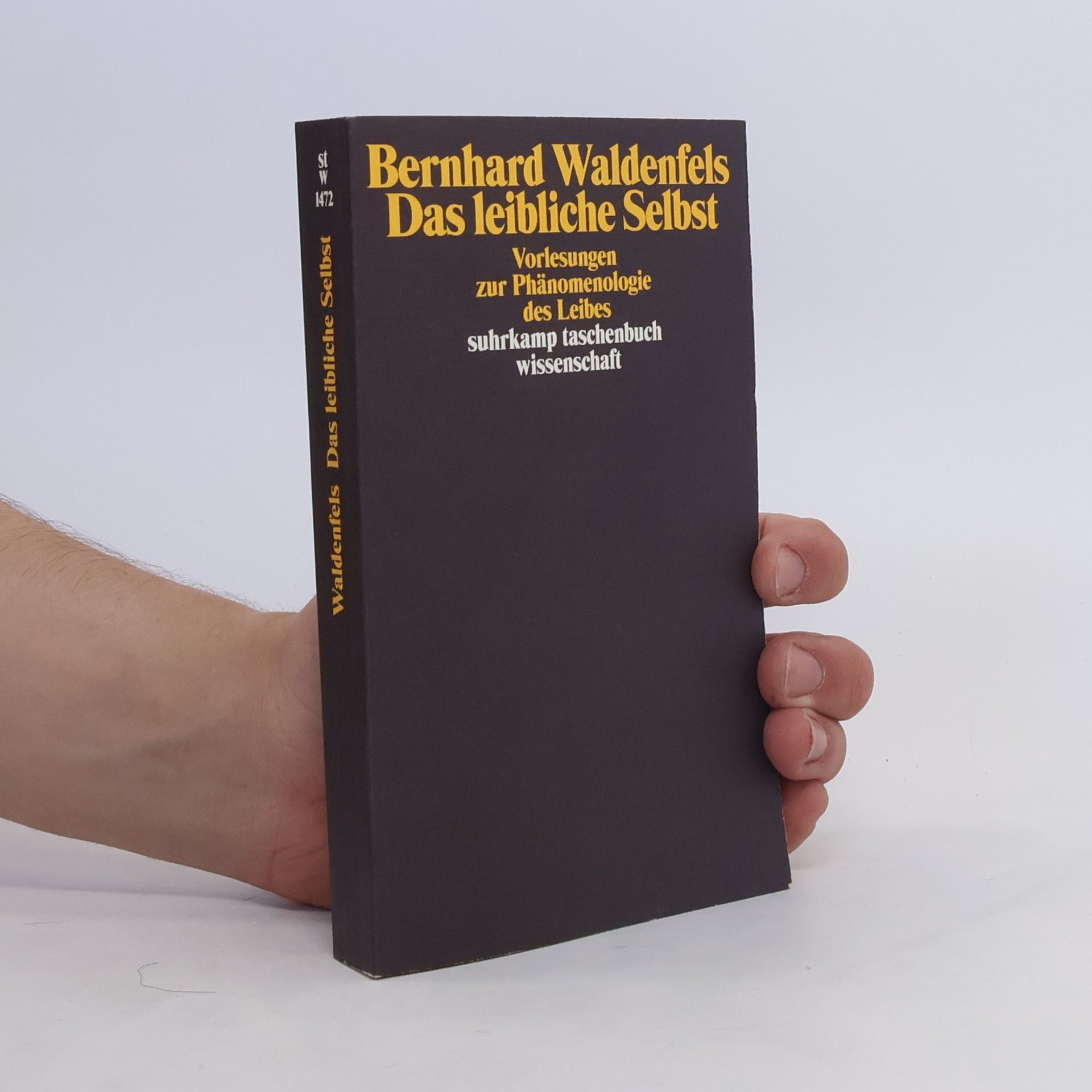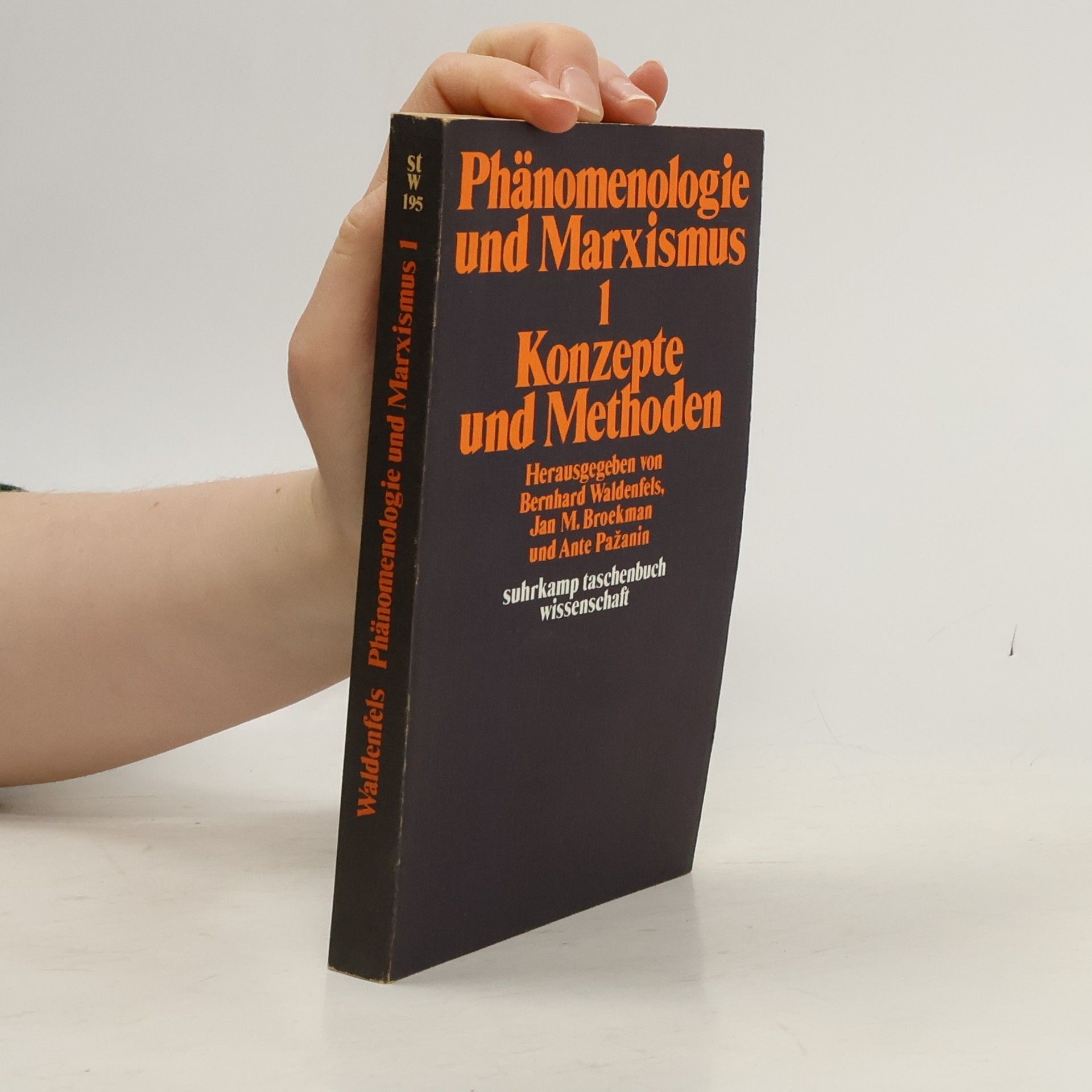Kniha obsahuje autorovy veřejné přednášky, které pronesl při různých příležitostech mezi polovinou 80. - 90. let.
Bernhard Waldenfels Knihy
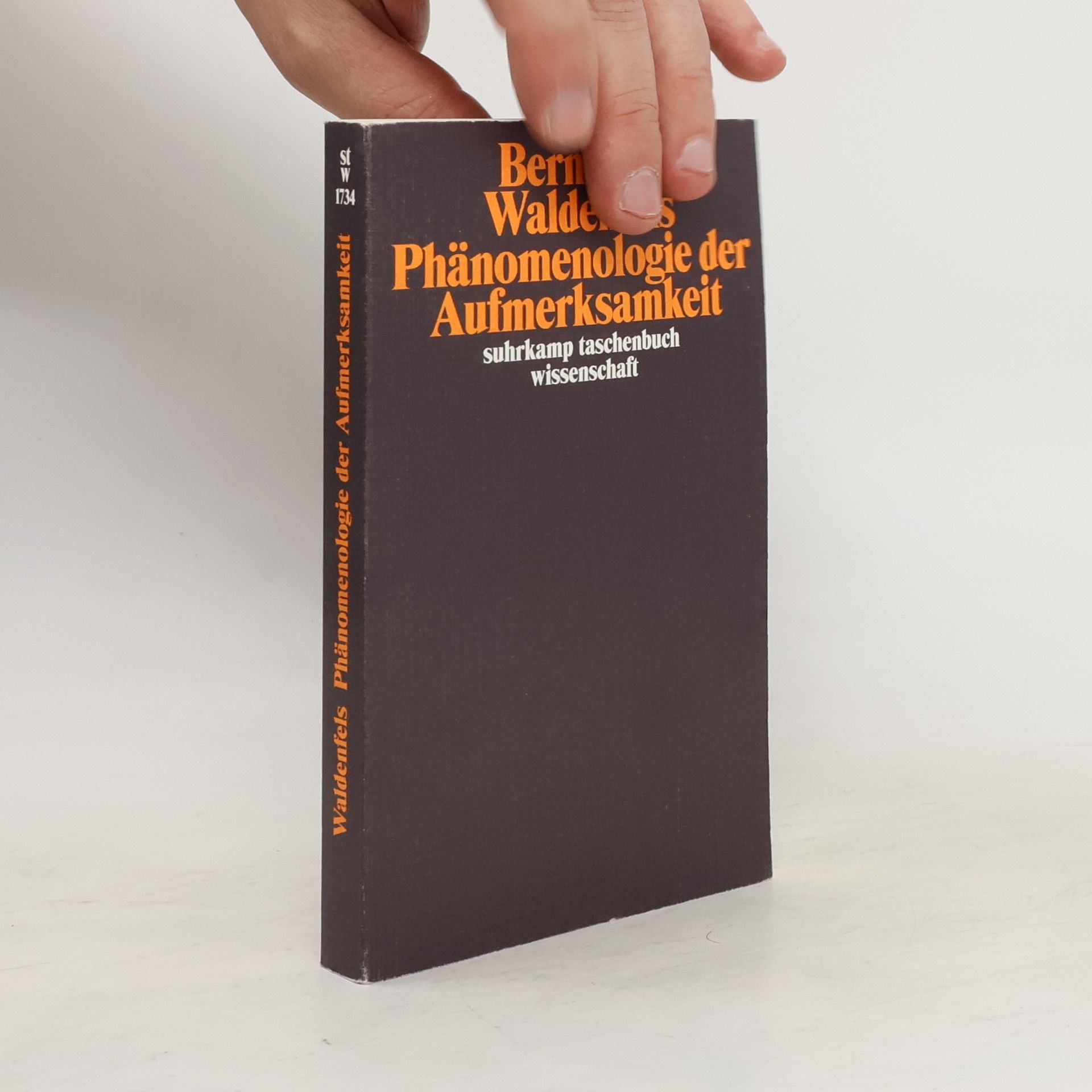


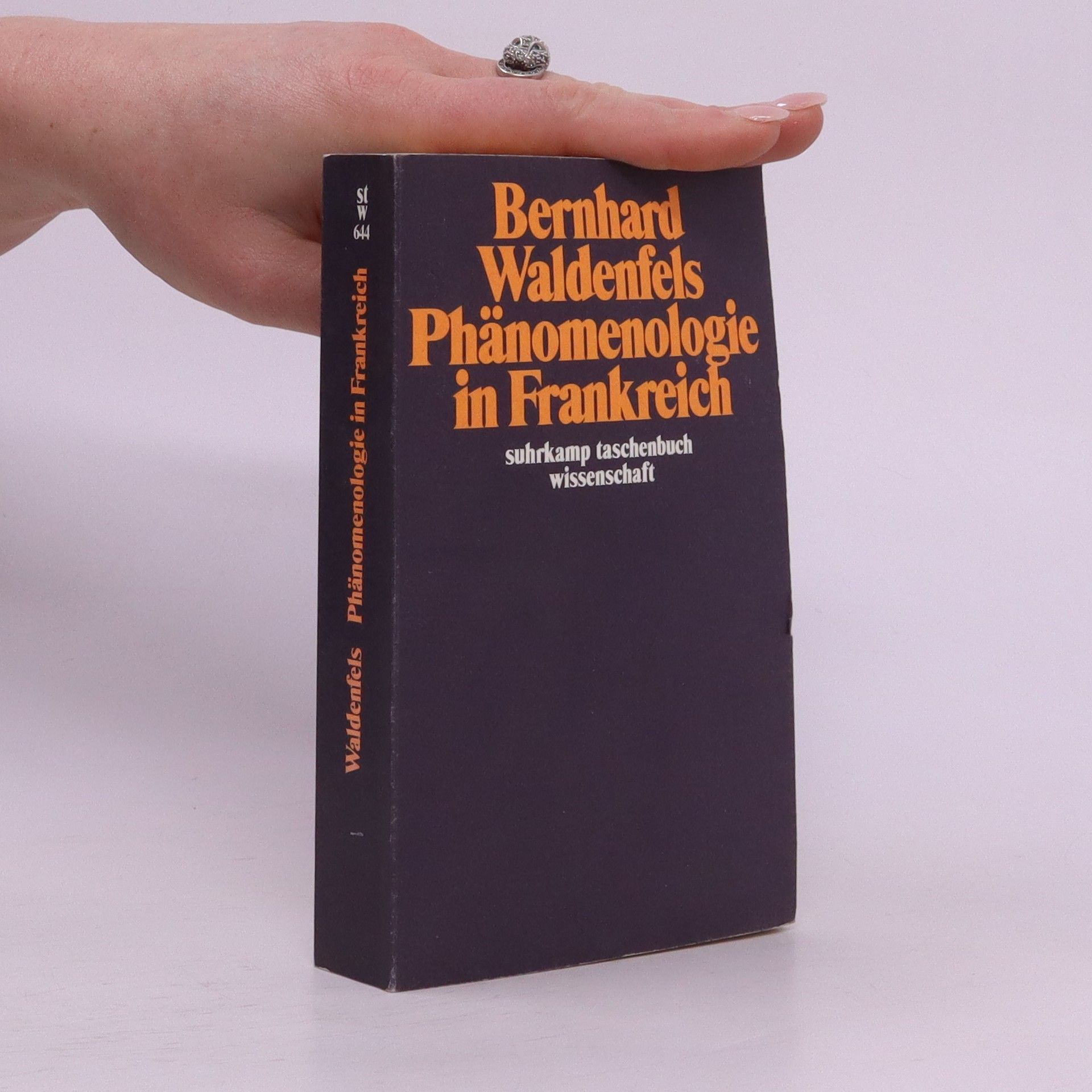

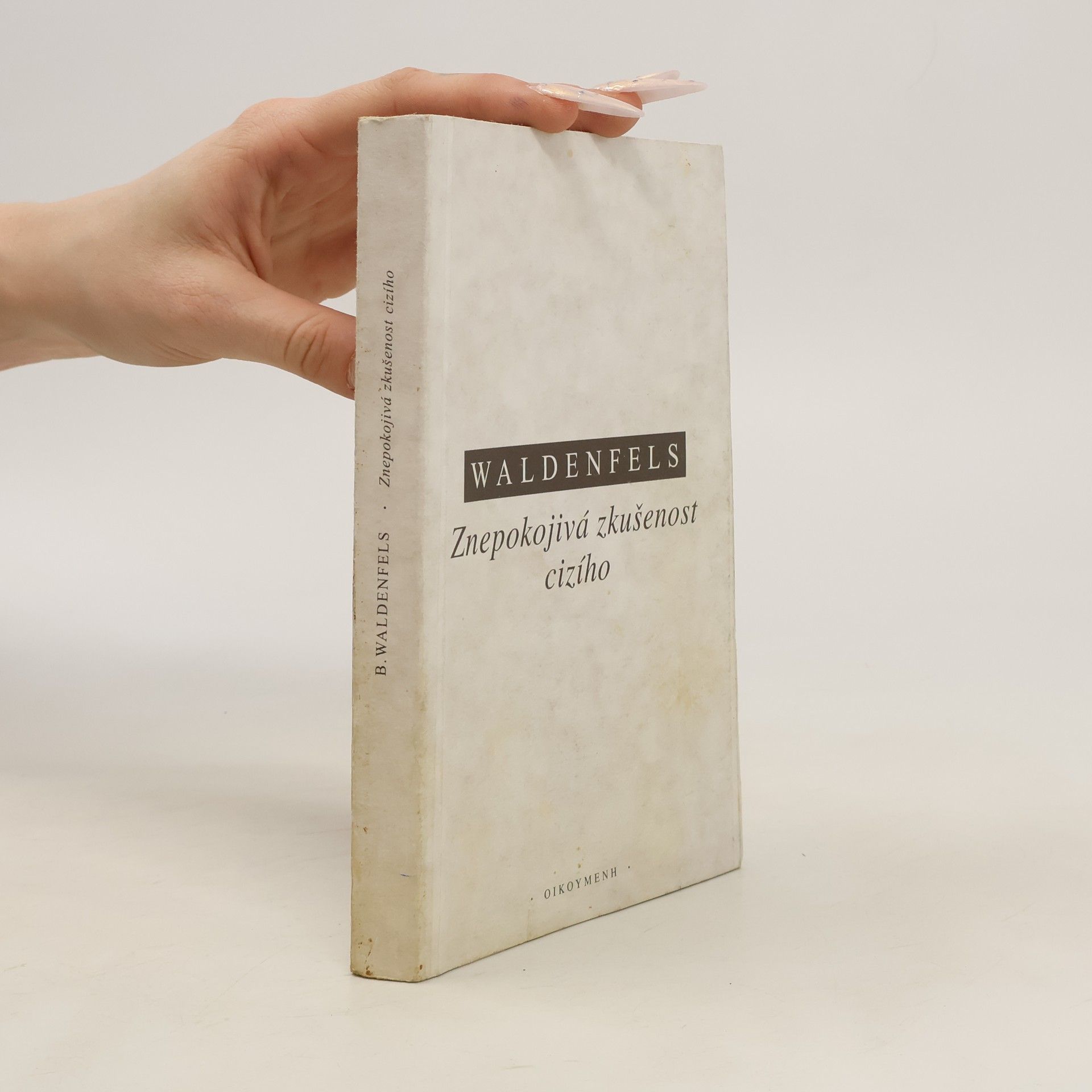
Základné motívy fenomenológie cudzieho
- 216 stránek
- 8 hodin čtení
Centrálnymi témami fenomenológie cudzieho sú podľa Bernharda Waldenfelsa poriadok, pátos, odpoveď, telo, pozornosť a interkulturalita. Ako výnimočné sa vynára cudzie vo forme narúšania, odklonov a nadbytkov vzhľadom na hranice poriadkov. Tým sa kladie otázka, ako sa dostaneme k cudziemu bez toho, aby sme ho zbavili jeho ostňa. Z toho vychádza responzívny charakter fenomenológie, ktorý vychádza za intencie a pravidlá v udalostiach a nárokoch. Odpovedajúce Ja sa predstavuje ako telesné Ja, ktoré nikdy nie je celkom pri sebe samom. Cudzie začína vo vlastnom dome. Začína už pri pozornosti, keď nás niečo zaujme. A nekončí napokon pri interkulturalite, ktorá je výzvou aj pre filozofiu. Globálne myslenie sa pritom nedá ani očakávať, a ani želať. Pokus prekročiť hranice bez toho, aby sme ich odstránili, patrí k dobrodružstvám cudzieho medzi kultúrami. Fenomenológia cudzieho má svojich predchodcov v autoroch ako M. Bachtin, S. Freud a H. Maus, ale aj I. Calvino, F. Kafka, R. Musil a P. Valéry.
Phänomenologie in Frankreich
- 588 stránek
- 21 hodin čtení
Die französische Phänomenologie hat seit ihren Anfängen in den 1930er Jahren wie keine andere Strömung Einfluß auf die Geisteswissenschaften des 20. Jahrhunderts genommen. Bernhard Waldenfels geht in seiner breit angelegten Studie diesen Wirkungen – mal als »Kommentator«, mal als »Kombattant« – sowohl historisch als auch systematisch nach, unter anderem anhand detaillierter Analysen zu Sartre, Merleau-Ponty und Ricœur. Nach wie vor aktuell, wie zahlreiche neuere Arbeiten zur Phänomenologie in- und außerhalb Frankreichs zeigen, ist dieses grundlegende Werk nun wieder lieferbar.
Wie ist ein Umgang mit wissenschaftlichen Modellen möglich, der die Fremdheit der Phänomene achtet? Wodurch wird die kulturelle Dynamik vor dem Leerlauf bloßer Selbsterhaltung bewahrt? Wie sieht eine medizinische Praxis aus, in der Krankheit nicht bloß als ein zu behebendes Defizit begriffen wird? Was bedeuten Natürlichkeit, Normalität und Wirklichkeit angesichts von Telepräsenz und Virtualisierung? Bernhard Waldenfels erkundet in diesem um vier Studien erweiterten zweiten Band seiner Studien zur Phänomenologie des Fremden die Unruhe, die aus den Spannungen zwischen Normalität und Anomalität erwächst.
Globalität, Lokalität, Digitalität
Herausforderungen der Phänomenologie
Eine Phänomenologie der Aufmerksamkeit gibt sich weder mit subjektiven Akten noch mit anonymen Mechanismen zufrieden. Sie bewegt sich zwischen Auffallen und Aufmerken in einem Schwerefeld, das die »Gewichte der Dinge« verändert. Wir sind daran beteiligt, aber nicht als autonome Subjekte. Dazu gehören räumliche Szenerien und zeitliche Verzögerungen. Etwas kommt auf uns zu, bevor wir darauf zugehen. Hinzu kommt ein Arsenal aus Techniken, Medien und sozialen Praktiken, das eine ökonomie und Politik der Aufmerksamkeit hervorbringt. Die Verankerung dieser Zwischeninstanzen im Leib, der als Leibkörper auch neurologische Prozesse und das Wirken des Unbewußten einschließt, widersetzt sich der Hypostasierung von Körperkonstrukten, Netzwerken und Machtpraktiken. Aufmerksamkeitskonflikte verweisen auf ein Ethos, das uns mit Unerwartbarem konfrontiert und in einer Beachtung gipfelt, die wir anderen schulden, ob wir es wollen oder nicht.
Das leibliche Selbst
Vorlesungen zur Phänomenologie des Leibes
Ausgehend von der Rätselhaftigkeit des Leibes werden zunächst verschiedene Dimensionen der Leiblichkeit wie Empfinden und Wahrnehmen, räumliche Orientierung und Bewegung, Spontaneität und Gewohnheit sowie Ausdruck und Sprache des Körpers entfaltet. Der anticartesianische Entwurf läuft methodisch auf eine Verflechtung von natürlichem und kulturellem, von eigenem und fremdem Leib hinaus. So eröffnen sich Perspektiven für eine Theorie der Generativität sowie für einen Polymorphismus des Geschlechtsleibes, jenseits von Naturalismus und Konstruktivismus. Am Ende steht der Ausblick auf ein leibliches Responsorium und ein entsprechendes Ethos der Sinne. Die Vorlesungen greifen zurück auf Husserls, Schelers, Plessners und vor allem auf Merleau-Pontys Phänomenologie des Leibes sowie auf die Gestalttheorie, Verhaltensforschung, medizinische Anthropologie und Pathologie. Gleichzeitig werden Brücken geschlagen zu neueren neurologischen Forschungen sowie zu Fragen der Körpergeschichte, der Körpertechnik und der Körperpolitik.
In den Netzen der Lebenswelt
- 247 stránek
- 9 hodin čtení
In kritischer Auseinandersetzungen mit Husserl und Merleau-Ponty geht es Waldenfels zunächst um die Verteidigung der Konzeption der Lebenswelt gegen ihre Wirkungsgeschichte, ja sogar gegen ihre Herkunftsgeschichte. In einer radikalisierten Phänomenologie – nicht anders als bei Foucault oder Derrida –, so zeigt sich, »zersplittert das Ursprüngliche«. Um dem dadurch drohenden Relativismus auf andere Weise zu entgehen als durch eine Totalisierung des Lebens oder eine Universalisierung von Normen, kann sich eine nichtmetaphysisch begründete Ethik auf einen Denker wie Levinas berufen. Anhand von Stichworten wie Alltag, Landschaft und Heimat entfaltet Bernhard Waldenfels zudem eine Phänomenologie der gelebten Räumlichkeit. Von dort aus lassen sich Brücken schlagen zu ökologischen Bestrebungen, die eine bewohnbare Welt zurückgewinnen trachten.
Studien zur Phänomenologie des Fremden 1
- 227 stránek
- 8 hodin čtení
Die von Waldenfels vorgelegten topographischen Erkundungen gehen von der Annahme aus, daß Fremdes nicht nur seine Zeiten, sondern auch seine Orte hat. Von Husserl und Heidegger, Merleau-Ponty und Levinas, Bachelard und Foucault werden Anregungen aufgegriffen, die zu einem orthaften Denken anleiten und in die Nähe der Ethnologie als einer Wissenschaft vom kulturell Fremden führen.