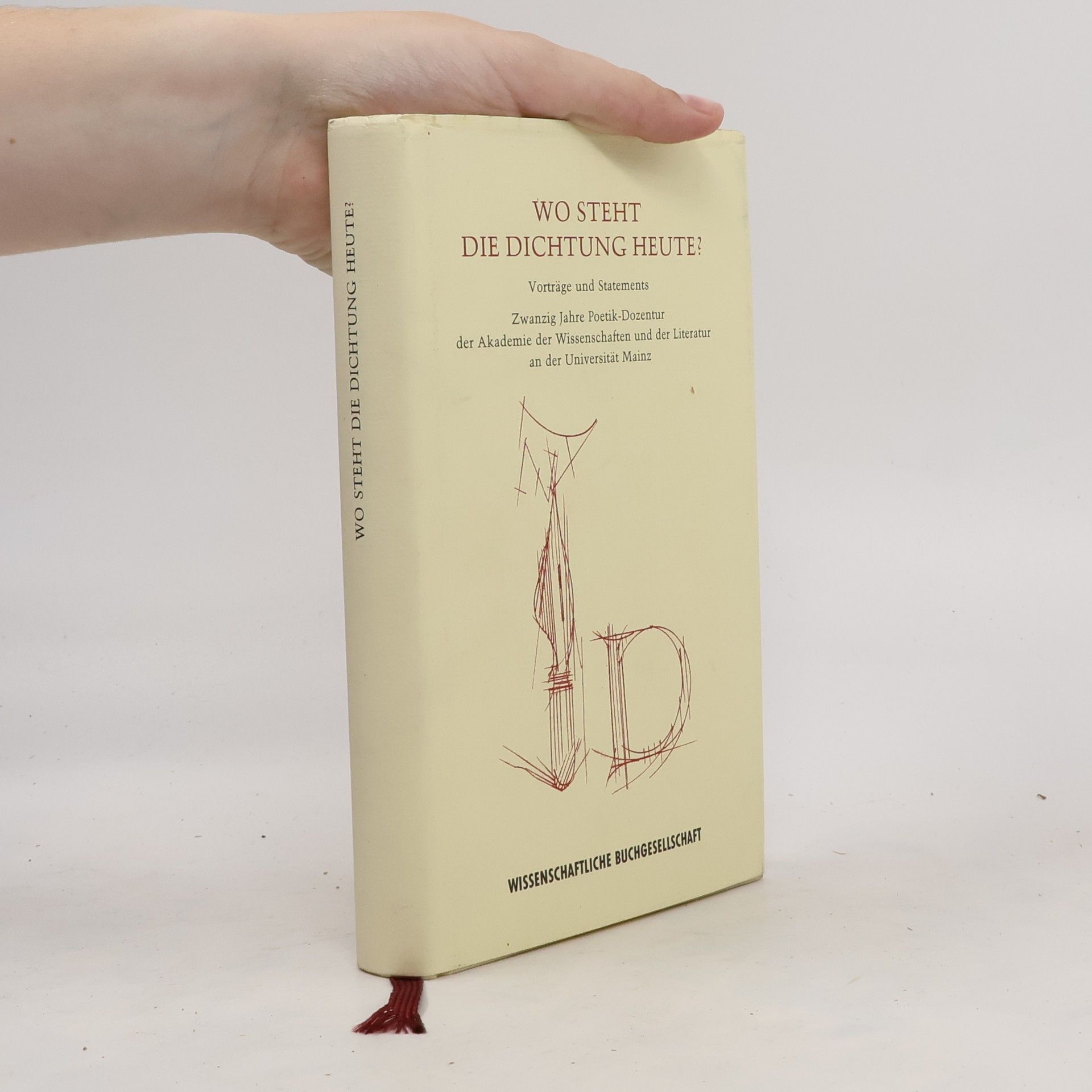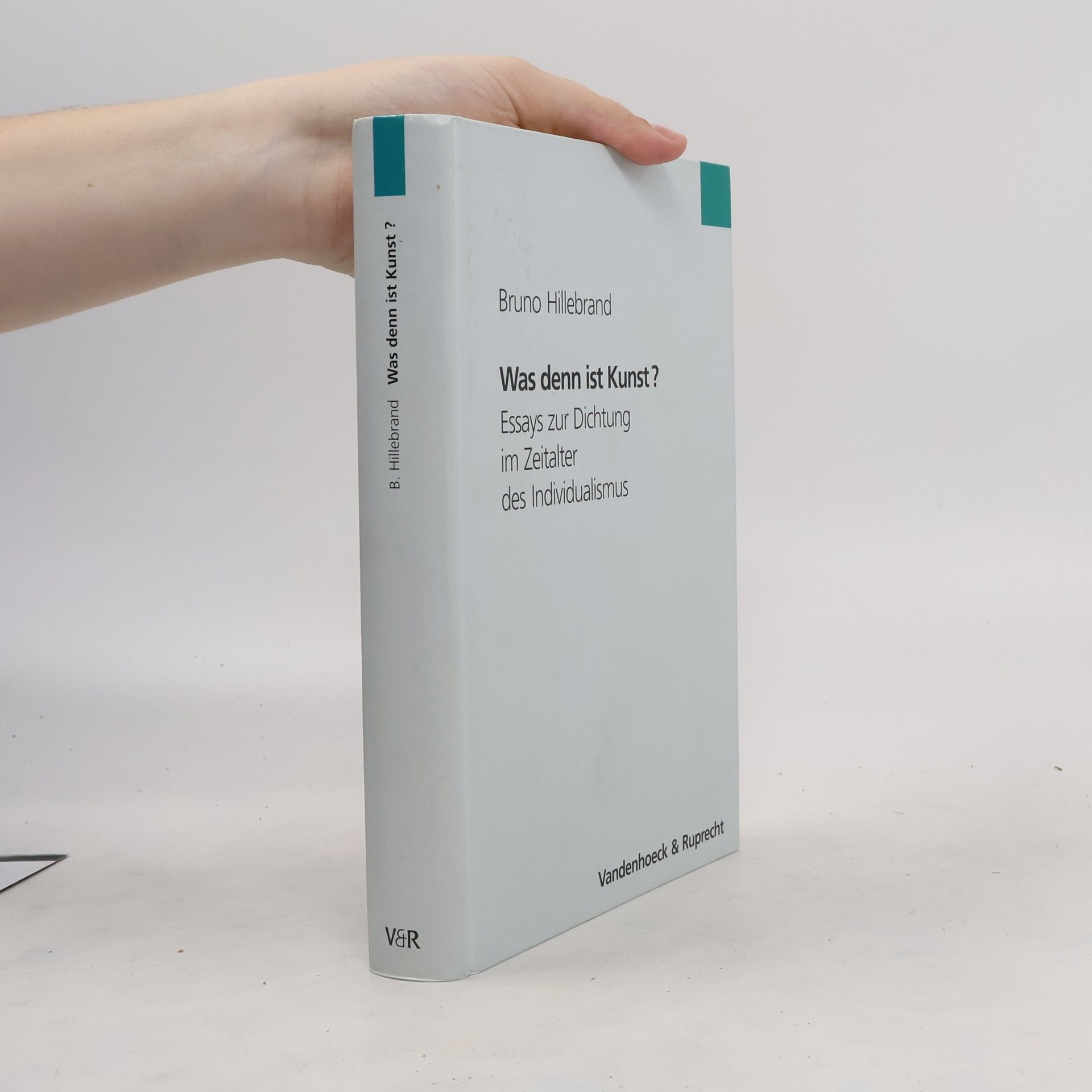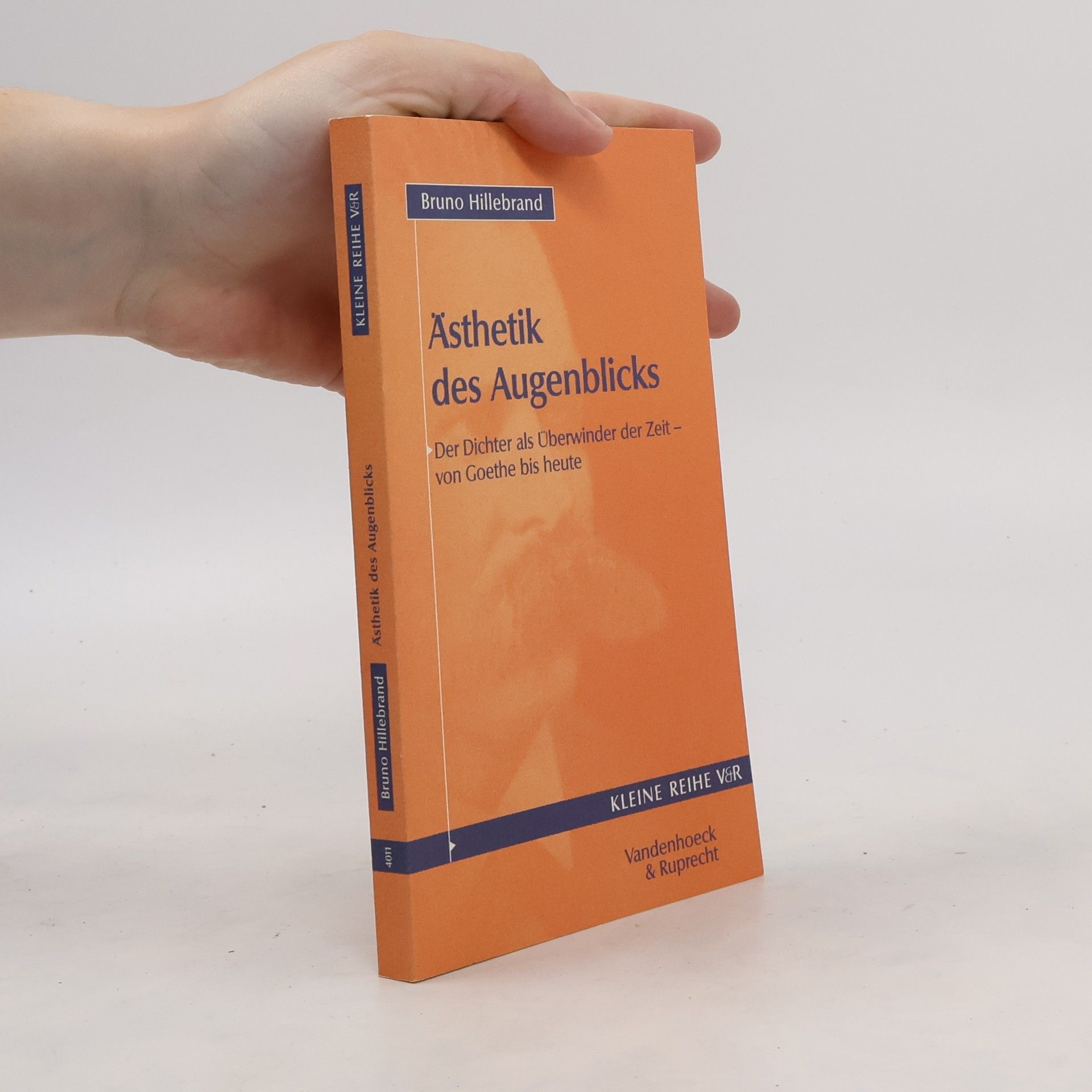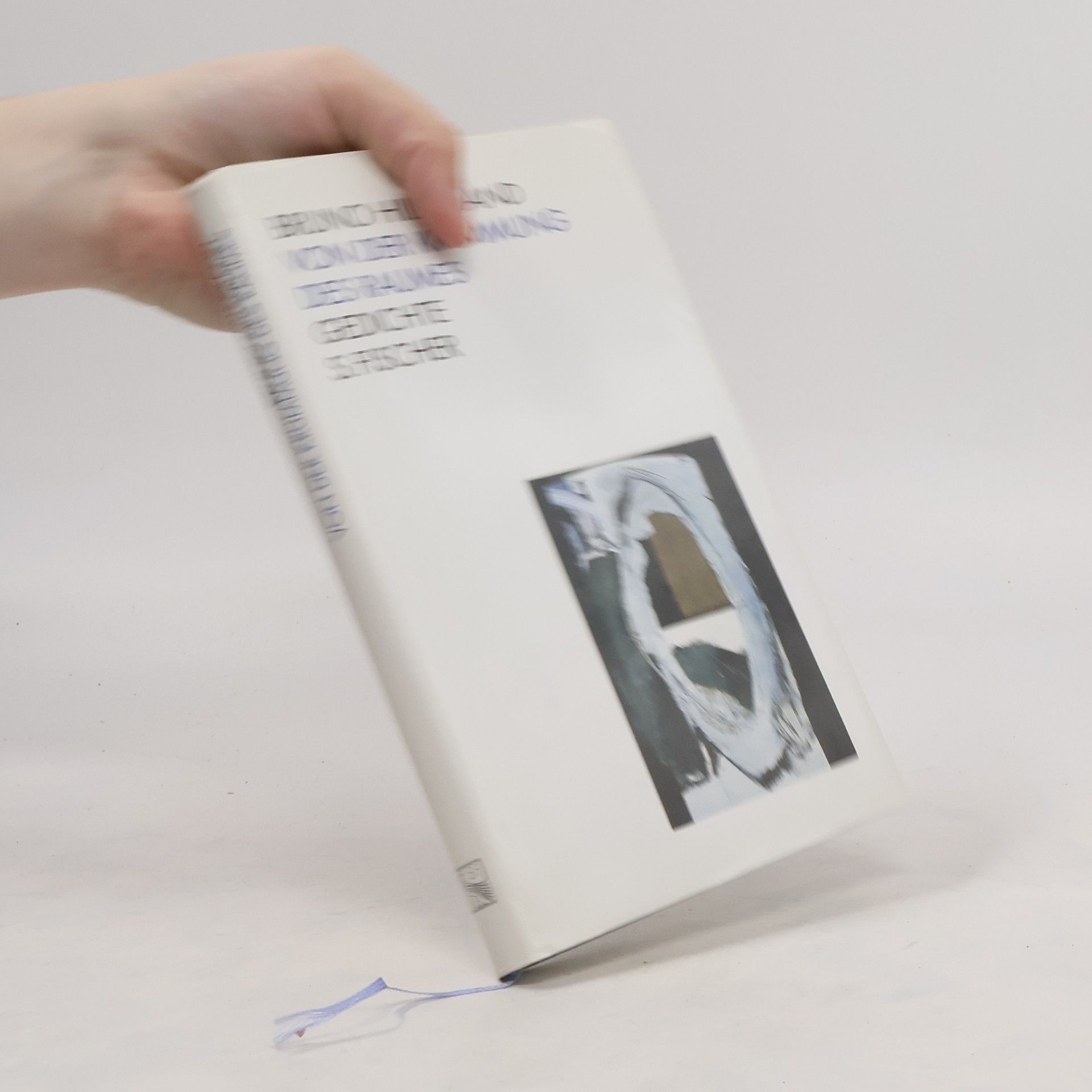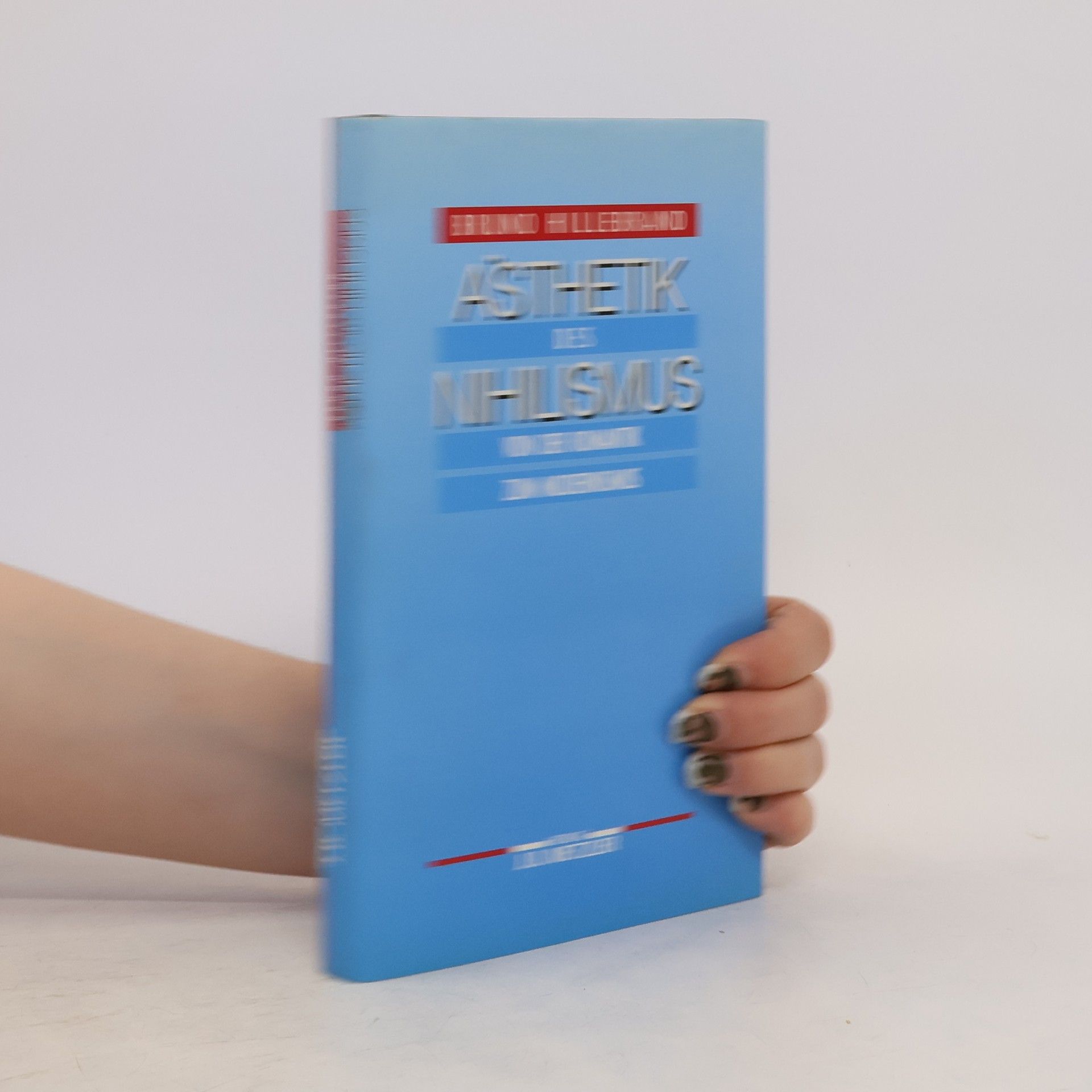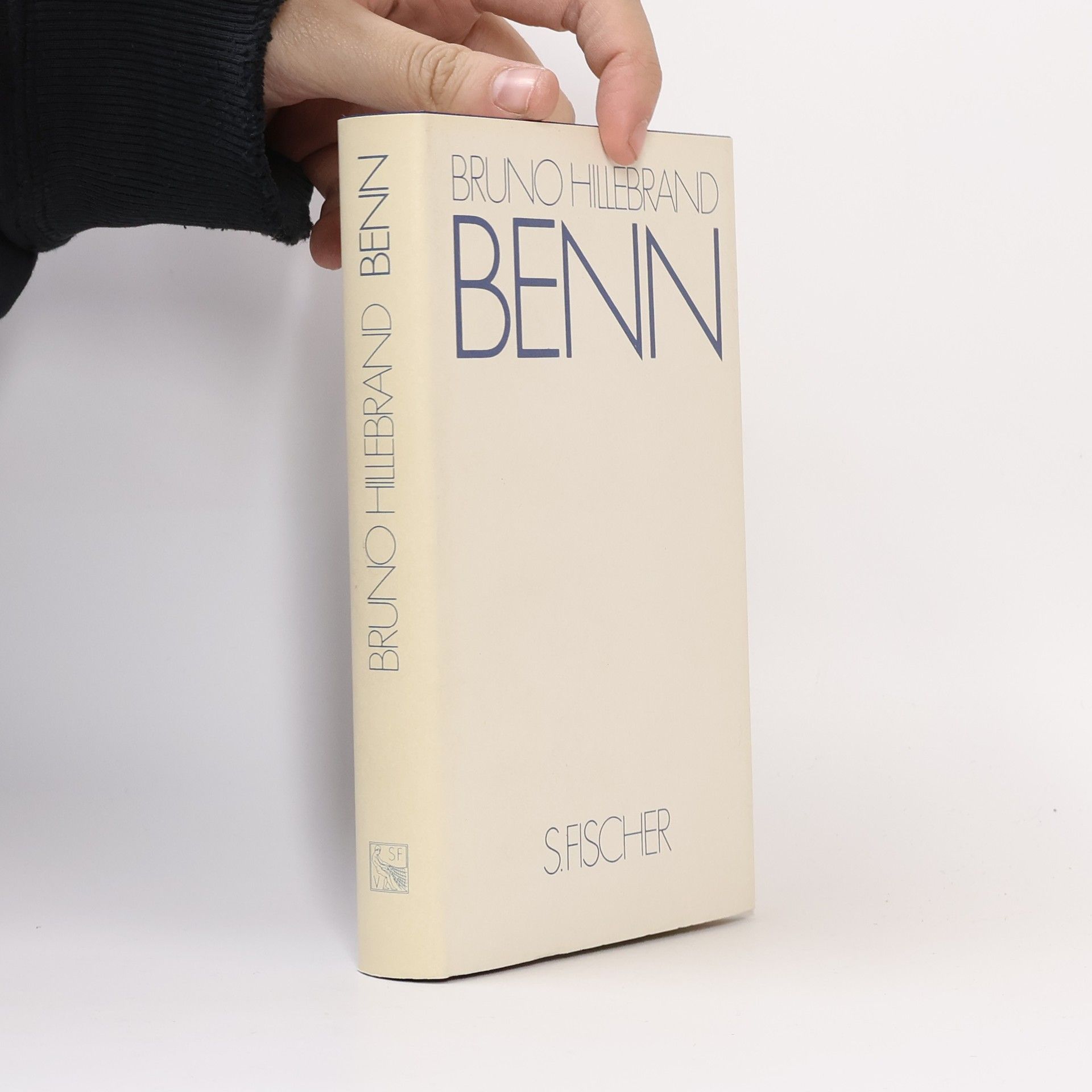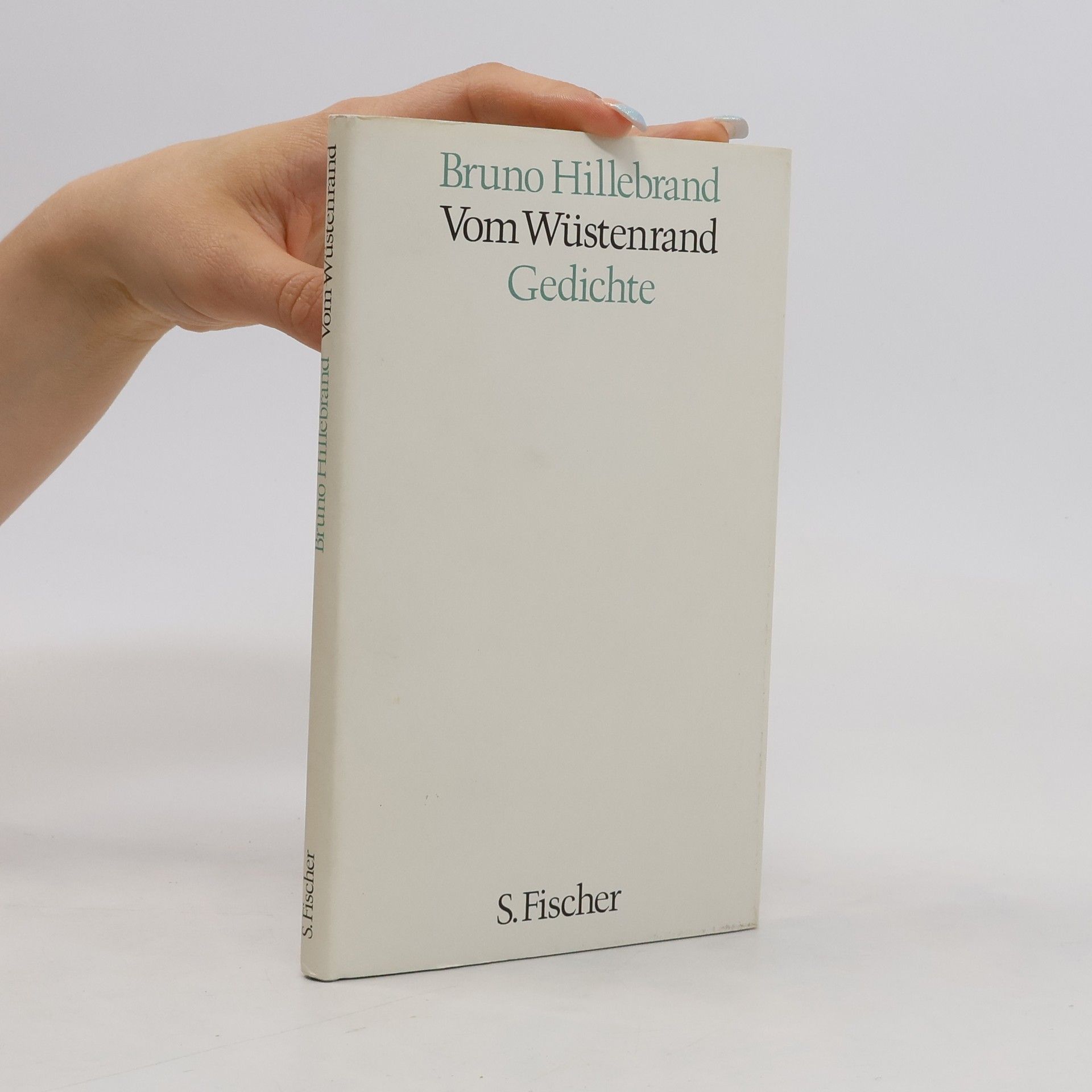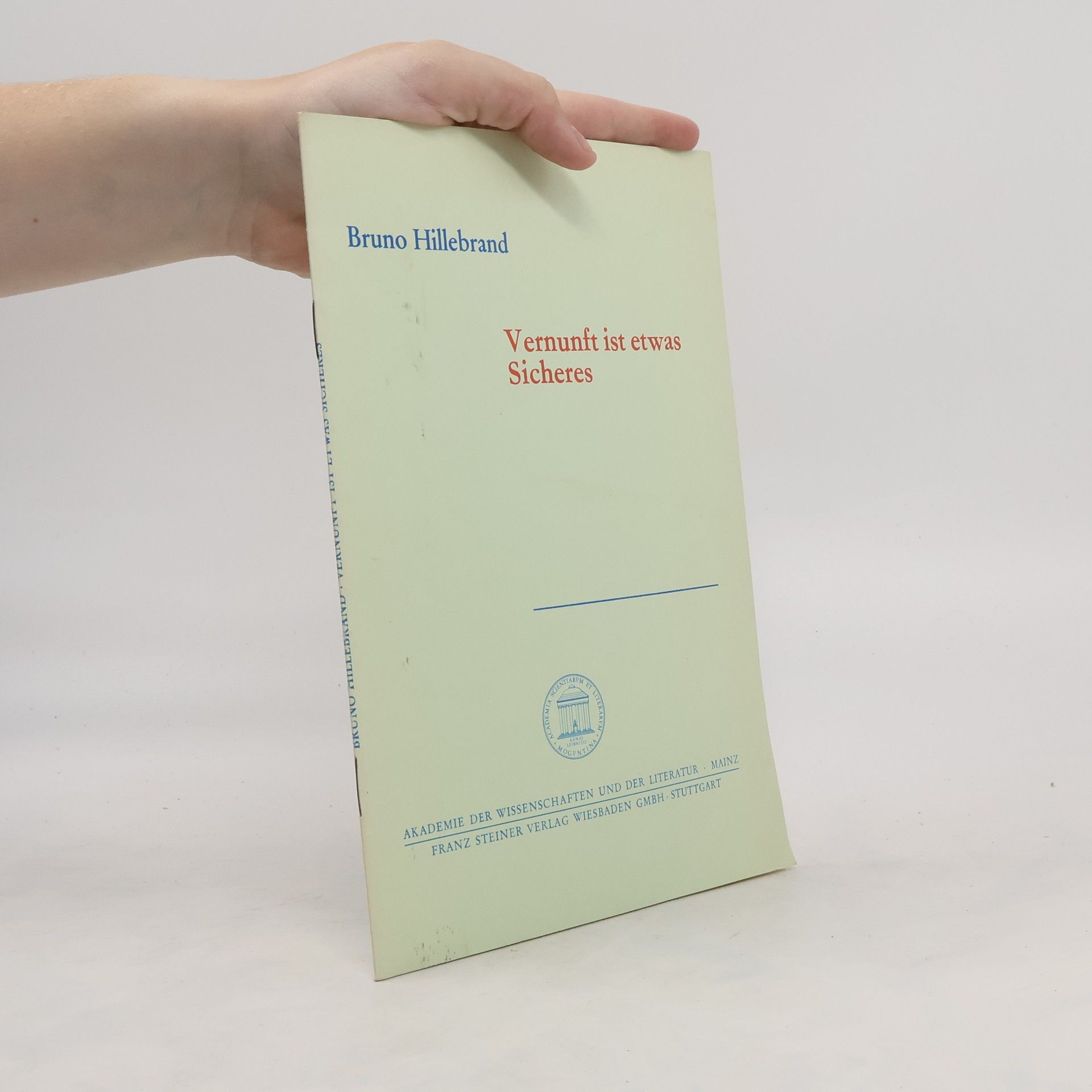Bruno Hillebrand Pořadí knih (chronologicky)
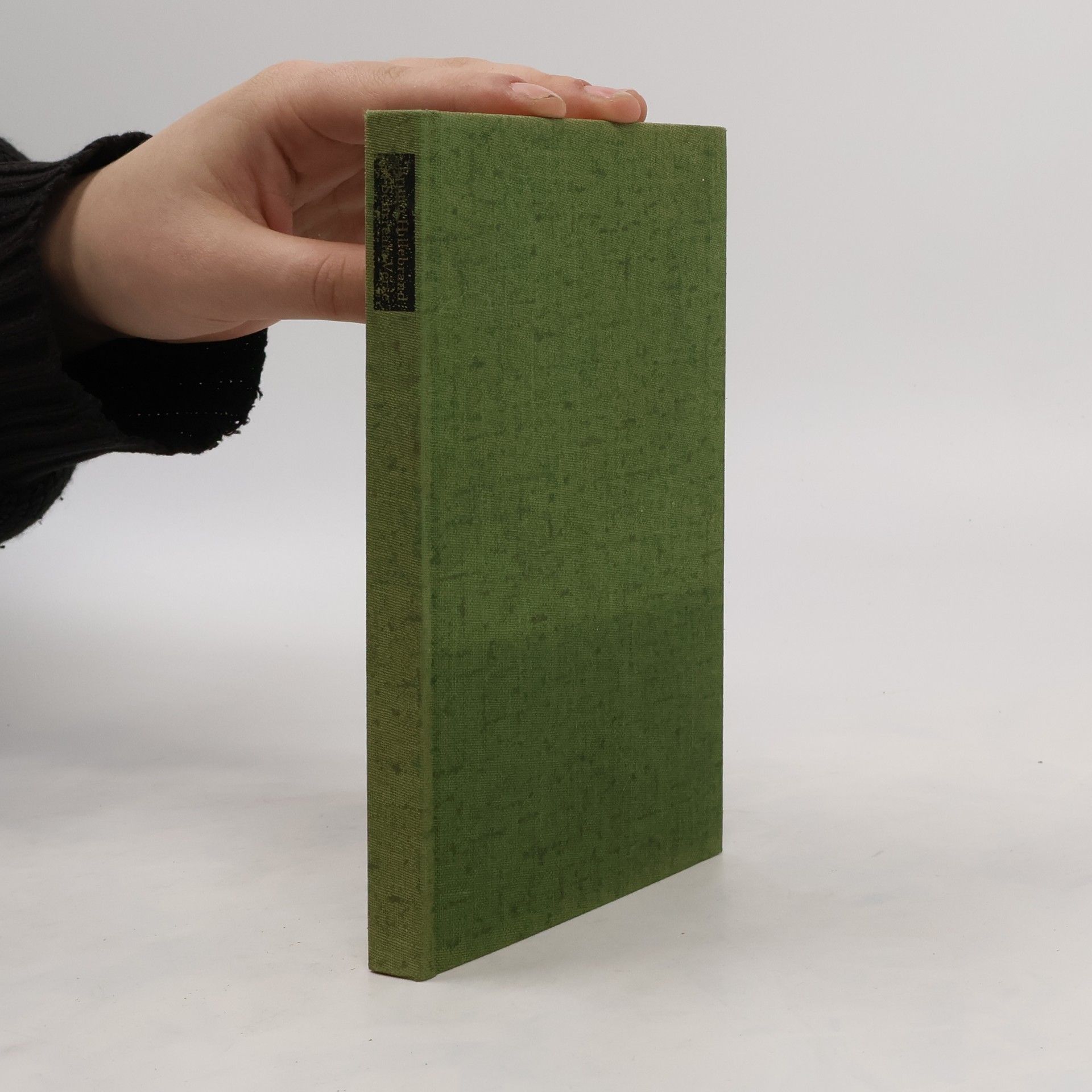


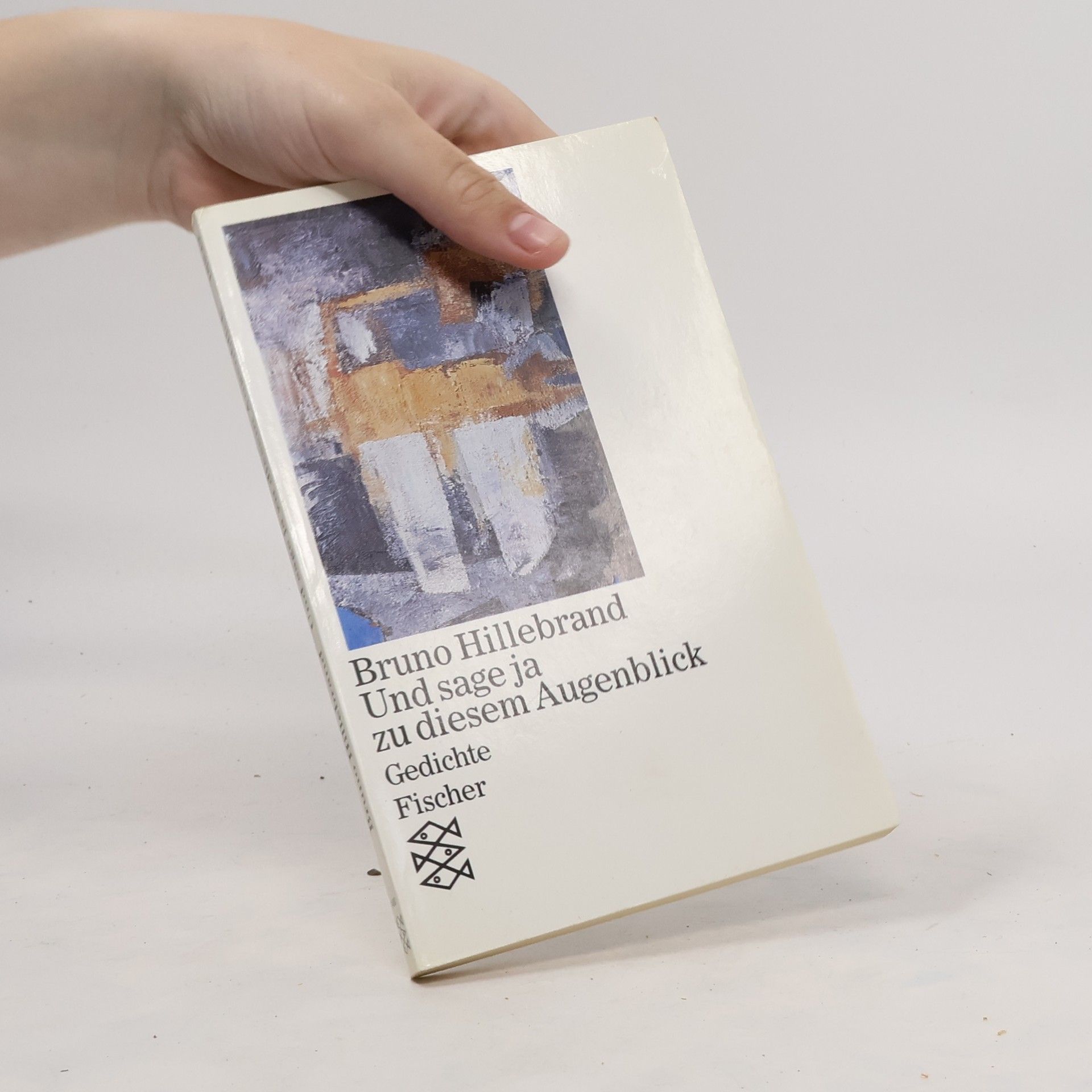

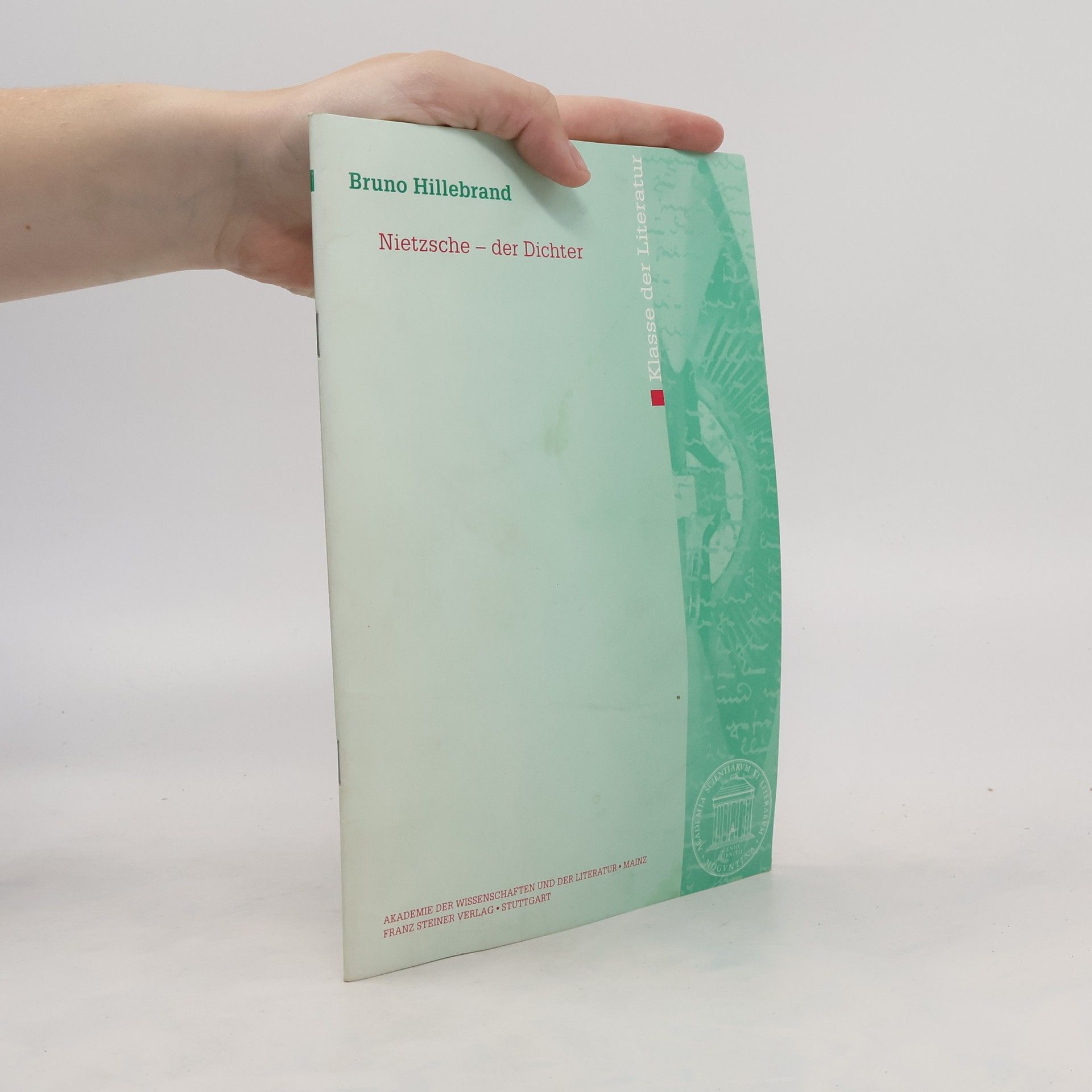
Was denn ist Kunst?
- 430 stránek
- 16 hodin čtení
Hillebrands Essays, hervorgegangen aus über dreißigjähriger Forschungstätigkeit, zeichnen die von Wechselhaftigkeit geprägte Positionierung der Kunst von der Goethezeit bis in unser Jahrhundert nach. Auf der Suche nach einer Standortbestimmung gehen die Aufsätze zuallererst der Frage nach, was denn Kunst eigentlich sei. Steht die Ära des Realismus im Zeichen des Epigonentums und resignativer Versöhnung, so eröffnet der mit Nietzsche aufblühende Nihilismus – paradoxerweise – eine neue Perspektive für die Kunst. Das Prinzip der Verneinung wird zum treibenden Moment in den Denkprozessen. Nachvollziehbar ist dieses Entwicklungsstadium etwa anhand des literarischen Schaffens von Gottfried Benn, den Hillebrand nach Goethe und Nietzsche in die historische Linie des Individualismus einreiht. Mit Blick auf die Postmoderne zeigt der Autor eine Abnutzung der ästhetischen Potenziale auf und beklagt die oft vergebliche Jagd nach innovativen literarischen Formen. Den Abschluss bilden ›Porträts‹, die sich meisterhaft einfühlen in unterschiedliche Gestalten des geistigen Lebens und ihre geschichtliche Stellung.
Nietzsche
- 160 stránek
- 6 hodin čtení
Kein Philosoph des Abendlandes hat die Dichter so exzessiv inspiriert und bewegt wie der Denker von Sils Maria: Ab 1890 beginnt die literarische Nietzsche-Begeisterung in Europa, zunächst mit einem eklatanten Missverständnis seiner Philosophie. Der Übermensch spukte in den Köpfen der Literaten des Fin de siècle als Macho-Typ, als l’homme supérieur, als superuomo, als overman und superman – natürlich als Mann, wie anders in dieser Zeit virilen Größenwahns. Nur langsam kommt ein angemessenes Verständnis auf; George, Hofmannsthal und Rilke machen den Anfang, es folgen Thomas und Heinrich Mann, Joyce, Hesse, Arnold und Stefan Zweig, Sternheim, Kraus, Döblin; in Frankreich Gide, Malraux, Camus – und schließlich der Apologet Benn, der zum 50. Todestag Nietzsches resümierte: »Für meine Generation war er das Erdbeben der Epoche.« Zu Nietzsches 100. Todestag im Jahr 2000 zeigt Bruno Hillebrands überzeugende Darstellung einer wohl einmaligen Wirkungsgeschichte ein faszinierendes Spektrum metaphysischer, ästhetischer und allgemein anthropologischer Art. Die Deutungen der Literaten unterscheiden sich fundamental von der philosophischen Exegese durch ihre subjektive Perspektivik, zudem durch ein oft leidenschaftliches Engagement im Umgang mit Nietzsches Philosophie und Person. Hillebrands Fazit: Es waren die Dichter, die uns den großen Denker in ihrer Art näher gebracht haben.
Ästhetik des Augenblicks
- 156 stránek
- 6 hodin čtení
Eine Ästhetik des Augenblicks ist eine Ästhetik der Zeit. Einer besonderen Form der Zeit, der ›eingestürzten‹, punktuell verdichteten Zeit, wie Bruno Hillebrand in seinem grundlegenden Essay ausführt. Dieser Zeit galt die poetische Hoffnung, aus der verlöschenden metaphysischen Materie noch einmal Funken zu schlagen. Seit der Aufklärung hat die Geschwindigkeit zeitlicher Erfahrung zugenommen: Je unaufhaltsamer die Ewigkeit am Horizont verschwand, um so mehr drängte sich die Zeit den Menschen auf. Zeit erzeugt durch ihr ständiges Verschwinden Angst; die Romantiker brachten das als erste Generation literarisch zum Ausdruck. Da die Ewigkeit als Glauben zurückliegt und als Utopie, als Hoffnung, voraus, bleibt dem Menschen nur eine Möglichkeit, Sein und Zeit in einem Schnittpunkt zu verdichten: in der Erfahrung des gesteigerten, erfüllten Augenblicks. Der Topos ›Augenblick‹ steht in diesem Sinne bei Goethe, bei Schiller, vor allem aber bei Kleist, bei Nietzsche und Benn im Zentrum der poetischen Vision. Blitz und Augenblick und Epiphanie werden zu literarischen Zeichen einer nicht mehr einholbaren Metaphysik. Episch wird der Augenblick zum generellen Strukturmoment bei Proust, bei Joyce, bei Virginia Woolf, Musil und anderen Romanciers der Weltliteratur in unserem Jahrhundert. Kulturphilosophisch erhob Ernst Bloch mit dem Prinzip Hoffnung den Augenblick noch einmal zu einem wesentlichen Faktor ontologischer Bestimmung.
Gedichtband mit existenzialistischem Schwerpunkt
Von Nietzsche bis Heidegger. Der Nihilismus als Geistesphänomen und Erlebnis zeigt sich zum ersten Mal in der deutschen Romantik. Er stand im Zentrum von Philosophie und Literatur im 19. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert hat sich der Nihilismus als Kulturphänomen - im Bereich aller Künste - fest etabliert. Mit Blick auf die Herkunft, vor allem auf Nietzsche, beschreibt Bruno Hillebrand die Geschichte der Ästhetik des Nihilismus.
Vom Wüstenrand
- 99 stránek
- 4 hodiny čtení