Thomas Ley Knihy

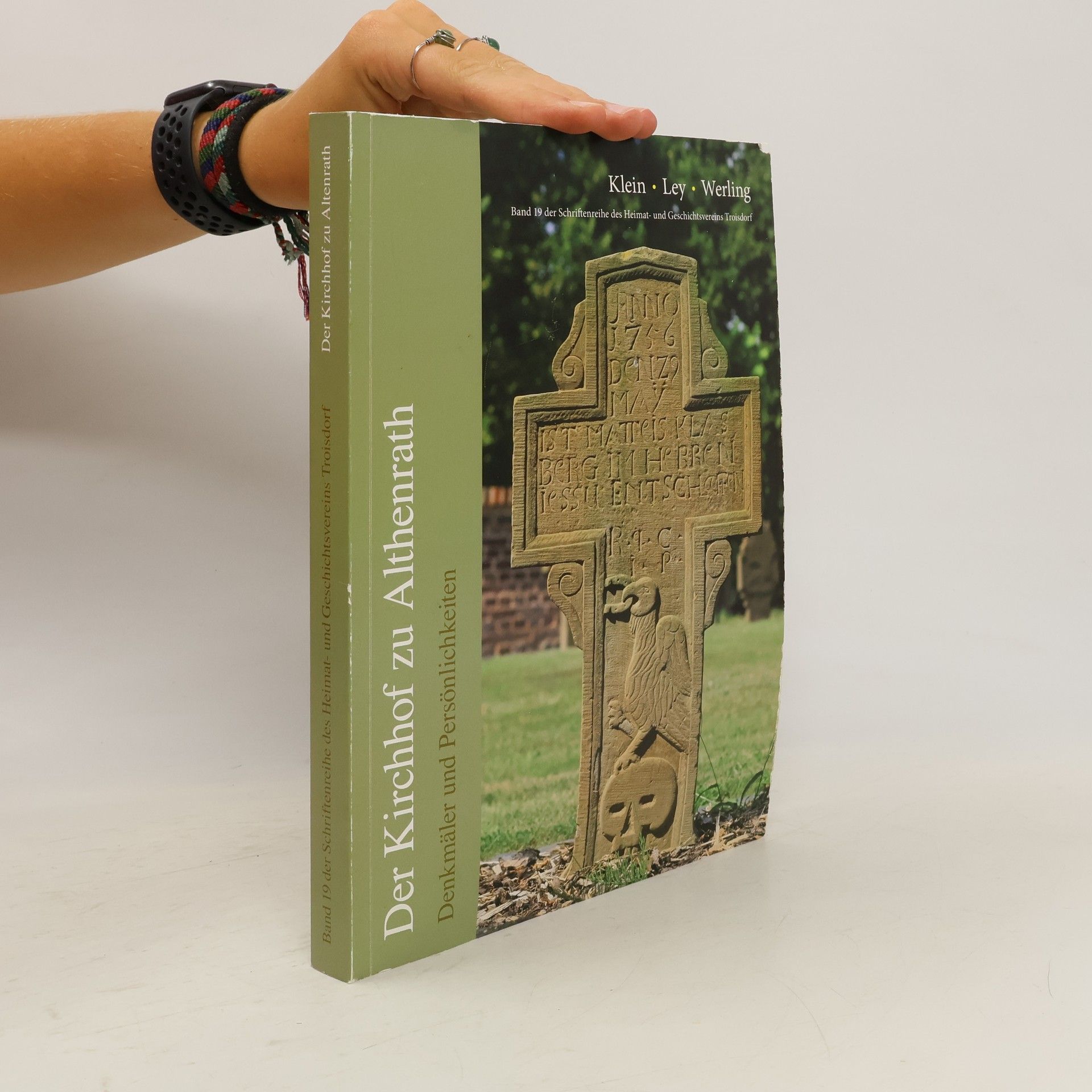
Zur Informatisierung Sozialer Arbeit
Eine qualitative Analyse sozialpädagogischen Handelns im Jugendamt unter dem Einfluss von Dokumentationssystemen
Die Arbeit analysiert digitale Dokumentationssysteme in der Sozialen Arbeit aus verschiedenen theoretischen Perspektiven. Ein Konzept dokumentarischen Handelns wird entwickelt und anhand von vier Fallstudien untersucht, wie Informationstechnologien das Handeln von Jugendamts-MitarbeiterInnen beeinflussen. Empirische Ergebnisse werden in organisationalen Deutungsmustern zusammengeführt.