Karl Friedrich Wessel Knihy
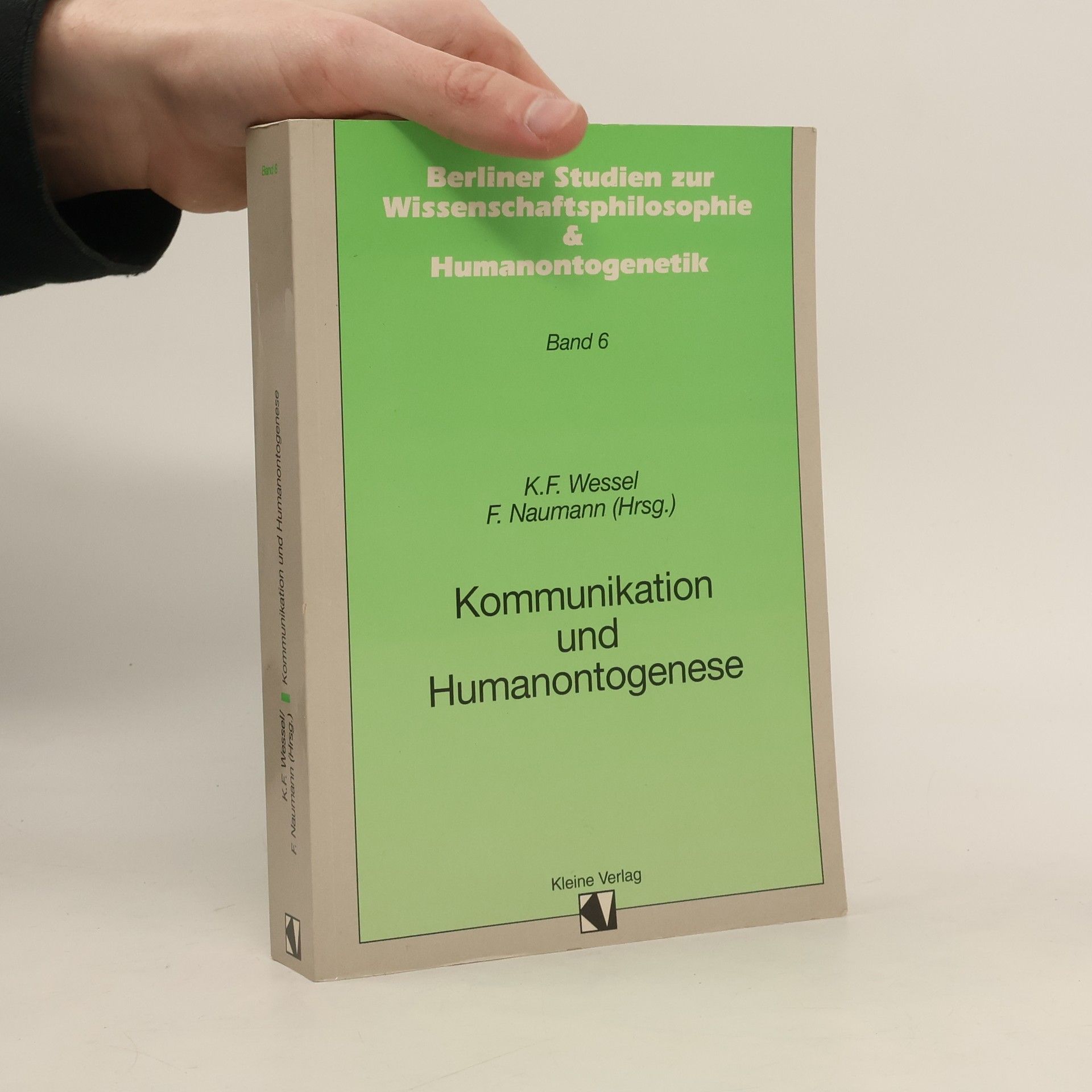
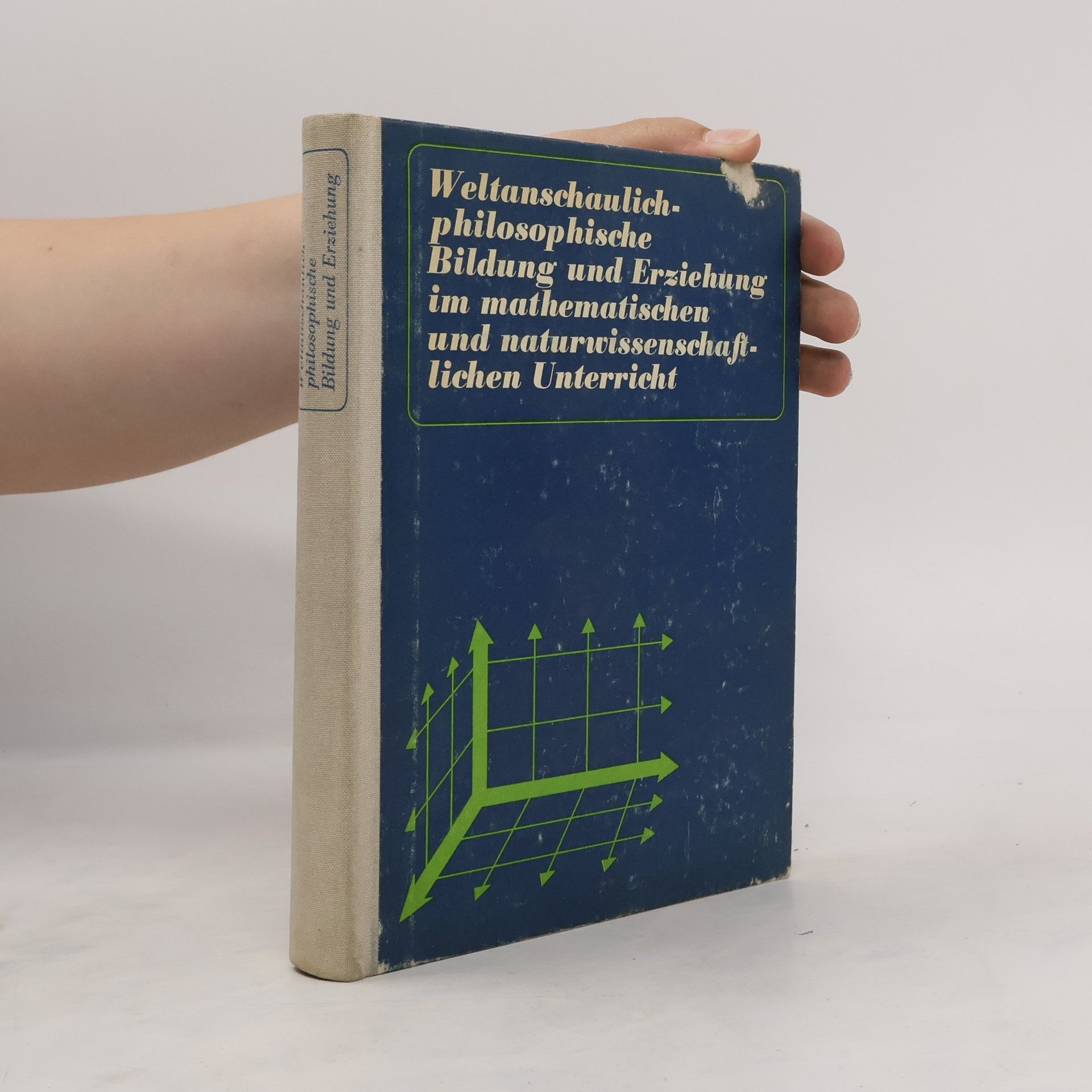
Kommunikation und Humanontogenese
- 591 stránek
- 21 hodin čtení
Kommunikation ist ein komplexes Phänomen, das von der Informationsübertragung im Tierreich bis zu philosophischen Gesprächsformen reicht. Ihre Erforschung verlangt ein interdisziplinäres Vorgehen. Kommunikation widersetzt sich schon vom Gegenstand her der Eingrenzung auf eine einzelne Disziplin; sie fordert das Gespräch und den gegenseitigen Austausch von Kenntnissen, weil sie selbst Gespräch und Austausch ist. Aus diesem Grunde organisierte das Interdisziplinäre Institut für Wissenschaftsphilosophie und Humanontogenese im März 1993 eine internationale Konferenz von Spezialisten der Biologie, Psychologie, Medizin, Linguistik, Soziologie und Philosophie, deren Beiträge in diesem Band versammelt sind. Sie zeigen, welche Breite Kommunikationsforschung erreicht hat und welche Theorien und Methoden sie zum besseren Verständnis der menschlichen Individualentwicklung zur Verfügung stellt. Die thematischen Schwerpunkte des Bandes sind: Vorbedingungen menschlicher Kommunikation / Frühe Ontogenese menschlicher Kommunikationsfähigkeit / Kommunikation und Medizin / Kommunikation und Kultur / Dialog und Toleranz – Perspektiven menschlichen Kommunizierens